Hass von allen Seiten
Offener Judenhass gilt in Deutschland seit dem Ende der NS-Terrorherrschaft eigentlich als geächtet. Trotzdem ist Antisemitismus alltäglich. Seit der Nahostkonflikt infolge des Terrorangriffs auf Israel eskaliert, wird jüdisches Leben so bedroht wie lange nicht. Ein Antisemitismus-Report von Michael Kraske.
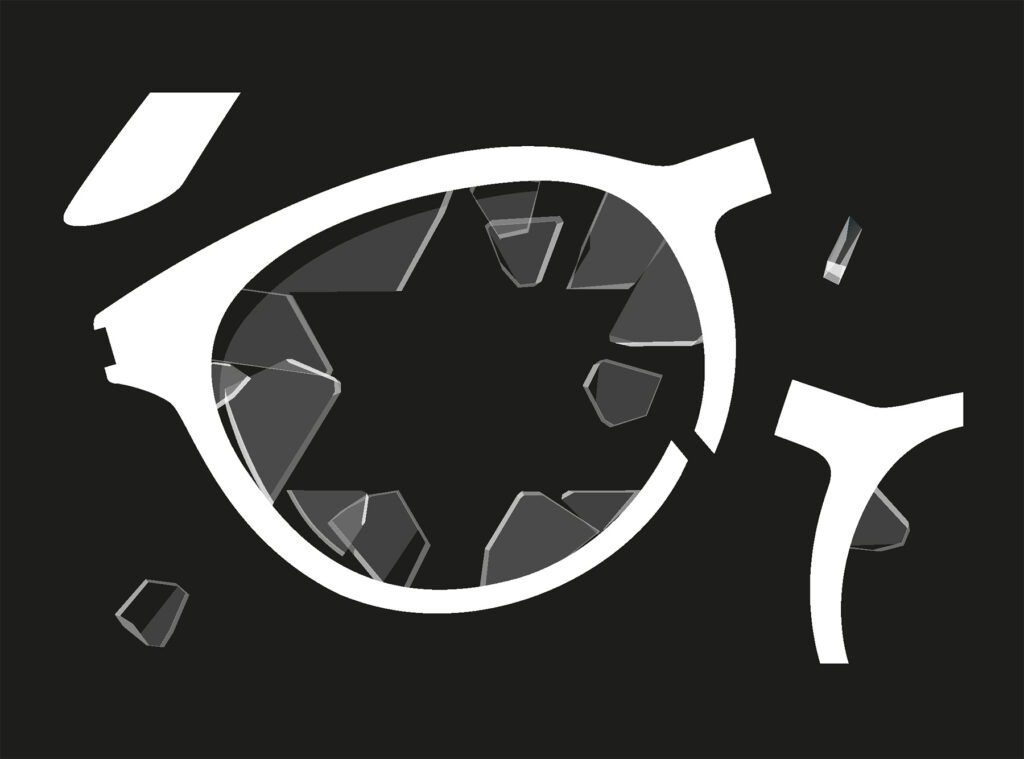
Dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel mit unvorstellbaren Gräueltaten und Massakern folgten tödliche militärische Gegenschläge Israels auf Gaza sowie weitere Raketenangriffe auf israelische Städte. Weltweit wächst seither die Furcht vor einem großen Krieg im Nahen Osten und einer humanitären Dauerkatastrophe im Gazastreifen. In Deutschland folgte auf den Terror gegen Israel eine antisemitische Hasswelle. Der 7. Oktober wird Israel als Tag des Grauens und der Erschütterung in kollektiver Erinnerung bleiben – so wie der 11. September den USA.
Rund 1.400 Menschen, darunter Kinder, Familien und Alte, waren von den aus Gaza eingedrungenen Terroristen ermordet worden. Die Terroristen vergewaltigten Frauen, schändeten und verstümmelten Leichen und stellten ihre Opfer öffentlich zur Schau. Mehr als 200 Personen wurden bei dem Angriff verschleppt und fortan als Geiseln gehalten. Zwar gab es daraufhin auch in deutschen Städten Solidaritätskundgebungen für Israel. Aber wie so oft, wenn der Nahost-Konflikt eskaliert, brach sich hierzulande rund um pro-palästinensische, israelfeindliche Demonstrationen und Krawalle offener Antisemitismus Bahn.
1) Mitten unter uns
In Hamburg wurden zwei Frauen mit einer Israel-Flagge nach einer Demo von zwei jungen Männern angegriffen und an Schulter, Arm und Kopf verletzt. In mehreren deutschen Städten wurden Israel-Fahnen angezündet. In den Münchner Stachus-Passagen nahm die Polizei einen Mann fest, der zuvor antisemitische Beleidigungen gebrüllt hatte. In Dortmund und Berlin schmierten Unbekannte Davidsterne auf Wohnhäuser, um Bewohnerinnen und Bewohner zu markieren und an den Pranger zu stellen. Aus der jüdischen Community wird über antisemitische Anfeindungen durch nichtjüdische Nachbarn berichtet. Die Gemeinde Kahal Adass Jisroel in Berlin-Mitte informierte über einen versuchten Brandanschlag mit Molotowcocktails.
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verurteilte unterdessen antisemitische Ausschreitungen und Anschläge gegen jüdische Einrichtungen. In Israel werden Jüdinnen und Juden abgeschlachtet – und in Deutschland, dem Land der Shoah, explodiert der Hass. Max Privorozki, der als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Halle/Saale vor vier Jahren den rechtsextremen Terroranschlag auf die dortige Synagoge überlebt hat, sieht jüdisches Leben seither so in Gefahr, wie er es sich nicht hätte vorstellen können.

Ein Mann betritt hinter Polizeiabsperrband die jüdische Gemeinde Kahal Adass Jisroel in Berlin-Mitte. Auf das Haus in Berlin wurde Mitte Oktober 2023 ein Brandanschlag verübt. Foto: Christoph Soeder/dpa
Die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) registrierten binnen einer einzigen Woche nach dem Terror-Angriff 202 antisemitische Vorfälle in Deutschland, ein Anstieg um fast 240 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die auf Antisemitismus spezialisierte Opferberatung OFEK (hebräisch für neue Horizonte) in Berlin musste aufgrund des großen Bedarfs kurzfristig ihr Angebot für Betroffene erweitern. Das Bundeskriminalamt (BKA) zählte infolge des Hamas-Terrors binnen weniger Wochen über 2.000 Straftaten, darunter Körperverletzungen, Volksverhetzung, Landfriedensbruch sowie Widerstand gegen die Polizei bei pro-palästinensischen Demos in Berlin.
Grünen-Politikerin Lamya Kaddor warnte vor islamistischen Gewalt-Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren: „Diese schrecklichen Gewaltdarstellungen von Folter und Mord werden ungefiltert und unkommentiert auf Schulhöfen geteilt.“ Es ist kein Zufall, dass sich der Hass auf Juden einmal mehr an einer Eskalation in Israel entzündet. Während der sogenannte klassische Antisemitismus hierzulande nach den NS-Menschheitsverbrechen weitgehend tabuisiert ist, wird israelbezogene Judenfeindschaft nicht nur von pro-palästinensischer Seite, Islamisten und in islamischen Milieus mit judenfeindlicher Sozialisation geteilt, sondern auch politisch von links bis rechts sowie in der bürgerlichen Mitte. Der Hass schlägt Jüdinnen und Juden derzeit bedrohlich von allen Seiten entgegen.
In der Wochenzeitung „Jüdische Allgemeine“ haben Jüdinnen und Juden beschrieben, wie es ihnen in Deutschland seit dem 7. Oktober ergangen ist: Die 25-jährige Deborah Feinstein erzählt dort etwa, wie ihr eine auf Hebräisch gesprühte Hassparole auf der Straße solche Angst eingejagt habe, dass sie fortan öfter zu Hause blieb. Eskaliere der Nahost-Konflikt, dann sei das in Berlin immer spürbar, aber noch nie so heftig wie jetzt. Michael Movchin (26) aus München berichtet, dass ihn derzeit sehr viele Hasskommentare auf Social Media erreichen. Neu sei, dass im Internet vor gefährlichen Orten gewarnt werde. Der junge Mann gibt an, seither vorsichtiger zu sein und nicht mehr in der Öffentlichkeit zu telefonieren.
Rabbinerin Yael Deusel (63) informiert darüber, dass jemand ein Hakenkreuz in ihr Arztpraxisschild in Bamberg gekratzt habe. Sie sorgt sich vor allem um die Sicherheit ihrer Patienten, Mitarbeiter und Gemeindemitglieder. Max Breslauer (38) schreckt in Süddeutschland jedes Mal hoch, wenn es an der Tür klingelt. Einige Nachbarn haben aufgehört, ihn zu grüßen. Das Stimmungsbild, das die Zeitung in der jüdischen Gemeinschaft eingeholt hat, ist alarmierend. Zwar äußern viele, sich nicht einschüchtern zu lassen. Doch die Angst ist allgegenwärtig.
2) Die Ächtung des Antisemitismus bröckelt
Die neuerliche Hochkonjunktur der Judenfeindschaft hat einen wenig beachteten Vorlauf. Diese Gewöhnungseffekte verschärfen die Lage zusätzlich. Es ist noch nicht lange her, dass bei Corona-Protesten mit sogenannten „Judensternen“ und der Aufschrift „Ungeimpft“ der Holocaust relativiert wurde, indem sich Demonstrierende mit NS-Opfern auf eine Stufe stellten. Seither kursieren auch wieder verstärkt antisemitische Verschwörungserzählungen über eine angeblich strippenziehende Elite. Wie so oft in Krisenzeiten werden Jüdinnen und Juden wieder zu Sündenböcken gemacht. Dieser Hass mündet immer häufiger in Taten. So erreichten antisemitische Delikte vor zwei Jahren laut der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes mit über 3000 Fällen ein Rekordniveau. Obwohl es seither vorübergehend weniger Demos und damit auch seltener Anlässe für Täter gab, gingen die Fallzahlen nur leicht zurück.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, stellt klar, „dass der Antisemitismus aus Deutschland nie weg war“. Doch während dieser phasenweise eher im Verborgenen geäußert worden sei, trete er nunmehr wieder zunehmend unverhohlen zutage: „Verschwörungserzählungen, Verharmlosung der Shoah und als Kritik an Israel getarnter Antisemitismus verbreiten sich längst nicht mehr nur am politischen Rand, sondern reichen in die Mitte der Gesellschaft hinein und sind auch in intellektuellen, akademischen Milieus zu finden.“

Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Foto: Bernd von Jutrczenka
Die Forschung unterscheidet einerseits zwischen einem klassischen Antisemitismus uralter Stereotype und Weltbilder über vermeintlich verschlagene Juden und ihren angeblich übergroßen und schädlichen Einfluss sowie modernen Ausdrucksformen andererseits: Beim Sekundären oder Schuldabwehr-Antisemitismus wird der Holocaust entweder geleugnet oder relativiert. Neuerdings eben auch dadurch, dass man auf Demos behauptet, aktuell einer Verfolgung wie seinerzeit die NS-Opfer ausgesetzt zu sein. Der Begriff Schuldabwehr beschreibt, dass diese Relativierungen dazu dienen, die deutsche Schuld am Holocaust herunterzuspielen. Nicht selten kommt es dabei zu einer Täter-Opfer-Umkehr. Der israelbezogene Antisemitismus benutzt den Staat Israel als Projektionsfläche und Aufhänger für Judenfeindschaft.
Die Forschung registriert seit einigen Jahren, dass in Deutschland die eindeutige Ächtung des Antisemitismus bröckelt. Vor drei Jahren stimmten laut Leipziger Autoritarismus-Studie (LAS) 41,1 Prozent der Befragten der Aussage zu: „Reparationsforderungen nutzen oft gar nicht den Opfern, sondern einer Holocaust-Industrie von findigen Anwälten.“ Ein weiteres Drittel stimmte dieser zynischen Unterstellung, wonach Reparationszahlungen dem Profit dienen, immerhin teilweise zu. Der beunruhigende Befund lautet: Wenn Antisemitismus nicht offen, sondern über einen Umweg wie etwa die unterstellte Instrumentalisierung der Shoah durch vermeintlich geldgierige Profiteure geäußert wird, ist er in großen Teilen der deutschen Gesellschaft anschlussfähig.

Polizeischutz für die Minderheiten
Was genau sind eigentlich Hassverbrechen? Wie lassen sie sich bekämpfen? Und was empfinden die Betroffenen? Eine Antwortsuche in München und Nürnberg.
Wenn der Staat Israel dämonisiert wird
Häufig tritt diese Form der Judenfeindschaft zusammen mit israelbezogenem Antisemitismus auf. In der besagten Studie der Uni Leipzig befürworteten 30,3 Prozent der Befragten: „Israels Politik in Palästina ist genauso schlimm wie die Politik der Nazis im Zweiten Weltkrieg.“ Hier wird die kritikwürdige israelische Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten mit der millionenfachen Ermordung von Jüdinnen und Juden durch das NS-Terrorregime gleichgesetzt. Der Staat Israel wird damit dämonisiert. Das ist übrigens ein Kriterium zur Unterscheidung. Denn natürlich ist auch harte Kritik an israelischer Politik legitim. Die Grenze zum Antisemitismus gilt etwa da als überschritten, wo der Staat Israel dämonisiert oder ihm das Existenzrecht abgesprochen wird und wenn Juden per se für die Politik Israels verantwortlich gemacht werden.
Traditionell gehört Judenfeindschaft zum festen Repertoire der radikalen Rechten. Seit Jahren werden die meisten antisemitischen Straftaten laut der Polizeilichen Kriminalstatistik von rechten Tätern verübt. Linker Antisemitismus gegen das vermeintlich imperiale und postkolonialistische Israel ist hingegen weniger bekannt. Sogar im Angesicht des barbarischen Terrors der Hamas wurde der Massenmord auch von Teilen der radikalen Linken relativiert oder gar als palästinensischer Freiheitskampf glorifiziert. Bei einer Demo vor dem Auswärtigen Amt in Berlin skandierten Teilnehmende: „Free Palestine from german guilt“, befreit Palästina von deutscher Schuld. Die deutsche Verpflichtung, für Israel einzustehen, die sich aus der Verantwortung für den Holocaust ergibt, soll demnach beseitigt werden.
3) Antisemitischer Alltag vor dem 7. Oktober
In Berlin hat Maria Kireenko schon lange vor dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel immer wieder Antisemitismus zu spüren bekommen. Kireenko hat in Göttingen Geschichte und Soziologie studiert und macht derzeit ihren Master-Abschluss in Osteuropastudien in Berlin. Neben ihrem Studium engagiert sie sich im Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und organisiert politische Bildungsangebote. Vor zwei Jahren, als es nach einer Eskalation im Nahen Osten ähnlich wie in diesem Herbst zahlreiche pro-palästinensische und israelfeindliche Demos gab, hat sie öffentlich gemacht, wie zwei ihrer Freundinnen in Berlin von mutmaßlich muslimischen Tätern auf der Straße angegriffen wurden, weil sie Halsketten mit einem Davidstern trugen. Andere Freunde seien mitten in Berlin beleidigt, bespuckt und bedroht worden, weil einer von ihnen ein Israel-Fähnchen bei sich trug.
Die Studentin bekannte damals, dass sie zuweilen Angst habe, die sozialen Medien im Internet zu nutzen, weil sie etwa beim Messenger-Dienst Telegram regelmäßig auf „antisemitischen Müll“ und „üble Relativierungen des islamistischen Terrors“ treffe. Diese stillen Rückzüge aus den digitalen Diskursräumen bleiben zumeist unbemerkt, tragen aber zur politischen Klimaverschärfung bei, weil nach und nach leise, besonnene Stimmen verstummen.

Maria Kireenko hängt bei einer Plakataktion des Jungen Forums der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Plakate zu den Ermordeten und Geiseln der Hamas in Berlin-Friedrichshain auf. Foto: Christoph Soeder/dpa
Maria Kireenko leistet freiberuflich politische Bildungsarbeit in Berlin-Neukölln, wo auch viele Muslime wohnen. Neulich, noch vor dem 7. Oktober, hatte sie eine Informationsveranstaltung über die Gründung des israelischen Staates mitorganisiert. „Schon im Vorfeld gab es viele Anfeindungen“, berichtet sie. „Wir mussten eine jüdische Sicherheitsfirma engagieren.“ Bei der Podiumsdiskussion habe es dann organisierte Störungen aus dem Umfeld der BDS-Bewegung gegeben, die sich als Sprachrohr der palästinensischen Zivilgesellschaft versteht und weltweit zum Boykott Israels und aller Personen aufruft, die mit dem israelischen Staat zusammenarbeiten; darunter Künstlerinnen, Sportler und Wissenschaftlerinnen. Die Störer traten Kireenko zufolge bei der Veranstaltung in Neukölln überaus aggressiv auf: „Zwei Personen sind richtig ausgeflippt.“ Immer wieder bekomme sie bei solchen Gelegenheiten zu hören, man dürfe Israel ja nicht kritisieren – von Personen, die das dann umso lauter und aggressiver täten.
„Juden werden für Israel verantwortlich gemacht“, beklagt Kireenko. Der Hass sei für sie nur schwer auszuhalten. Sie versuche mittlerweile, auf eigene Belastungsgrenzen zu achten. „Ich habe mich zu schützen gelernt“, sagt die Studentin. „Man entscheidet sich bewusst, wo man sich als jüdisch zu erkennen gibt.“ Dazu gehört auch, sichtbare Symbole wie den Davidstern bisweilen zu verbergen. „Verwalten von Sichtbarkeit“ nennt sie das: „In manchen Situationen entscheide ich mich dafür, ihn wegzustecken.“ Sie habe auch schon zu hören bekommen, in Neukölln offen jüdisch aufzutreten sei „eine Provokation“. Die engagierte Studentin formuliert eine Einschätzung, die aufhorchen lässt: „In Deutschland verändert sich etwas.“ Dieses Gefühl wachsender Bedrohung unter Jüdinnen und Juden deckt sich mit den Erkenntnissen aus der Strafverfolgung und von Sozialforschenden. Antisemitismus wird im Land der Shoah wieder lauter, aggressiver und gefährlich normal – nicht erst seit dem Terror der Hamas.
Die Kippa tragen viele Gläubige nur in der Synagoge, auf deutschen Straßen ist es zu gefährlich. Immer wieder gibt es Berichte über Angriffe auf erkennbar jüdische Menschen.
Die Erfahrungen der Berliner Studentin sind weder Einzelfall noch Ausnahme. Antisemitismus prägt den Alltag vieler Jüdinnen und Juden, auch wenn die Mehrheitsgesellschaft davon kaum Notiz nimmt. Der rechtsextremistische Terroranschlag im Herbst 2019 mit zwei Mordopfern, als ein hasserfüllter Attentäter an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, versuchte, ein Massaker an betenden Jüdinnen und Juden in der Synagoge in Halle/Saale zu verüben, hat daran nichts geändert. Die Sicherheitsvorkehrungen in jüdischen Einrichtungen wie Gemeindezentren und Kindergärten wurden danach nicht nur in Halle, sondern bundesweit verstärkt, beispielsweise auch an der Synagoge in Dresden.
Betroffene müssen sich seither noch stärker zwischen der Sichtbarkeit ihrer jüdischen Identität und der eigenen Sicherheit entscheiden. Die Kippa tragen viele Gläubige nur in der Synagoge, auf deutschen Straßen ist es zu gefährlich. Immer wieder gibt es Berichte über Angriffe auf erkennbar jüdische Menschen. Allen jüdischen Kulturwochen und Gedenktagen zum Trotz ist Antisemitismus in der gesellschaftlichen Praxis nicht nur alltäglich, sondern auch so schmerzhaft spürbar, dass Betroffene gezwungen sind, sich in ihrer Lebensführung massiv einzuschränken.
4) „Eigentlich gehört ihr nicht hierher“
Nora Goldenbogen hat der Antisemitismus ein Leben lang beschäftigt. Wie sehr, das habe sie sich seinerzeit als junge Frau gar nicht vorstellen können, sagt sie. Goldenbogen ist Lehrerin, Historikerin und Autorin. Viele Jahre hat sie die Jüdische Gemeinde in Dresden geleitet. Mittlerweile ist sie im Landesverband für die drei sächsischen Gemeinden in Dresden, Leipzig und Chemnitz zuständig. Mit dem Verein Hatikva hat sie sich für politische Bildung und Aufklärung engagiert. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, die Synagoge in Dresden zu einem Ort der Begegnung zu machen, mit Podiumsdiskussionen und einer offenen Gesprächskultur. Kürzlich hat Nora Goldenbogen ein berührendes Buch über die Geschichte ihrer Eltern veröffentlicht, in dem sie von der jüdischen Mutter und dem kommunistischen Vater und Widerstandskämpfer erzählt, die nur knapp der nationalsozialistischen Vernichtung entkamen und nach dem Ende des NS-Terrors nach Dresden zurückkehrten, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Für ihr kritisches Engagement wurde die Autorin mit der Ehrenmedaille der Stadt Dresden ausgezeichnet.
Antisemitismus begegnet Nora Goldenbogen immer wieder, in ganz unterschiedlichen Formen. „Bis heute werde ich für die Politik von Israel verantwortlich gemacht, auch wenn ich in Dresden geboren bin“, erzählt sie. Als deutsche Jüdin bekommt sie des Öfteren zu hören: „Was macht denn Ihre Regierung da?“ Gemeint ist dann wohlgemerkt nicht die deutsche, sondern die israelische Regierung. Eine gängige Zuschreibung sei, ihr aufgrund ihrer jüdischen Identität die Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft abzusprechen, nach dem Motto: „Eigentlich gehört ihr nicht hierher.“ Nicht selten würden auch Relativierungen des Nationalsozialismus wie diese geäußert: „Die (Anm. der Redaktion: Israel) sind ja auch nicht besser als die Nazis.“ In der Öffentlichkeit entstand zuletzt wieder der Eindruck, dass Antisemitismus vor allem ein Problem zugewanderter Muslime sei, eine Art Import also.
„Es ist eine historische Tatsache, dass Antisemitismus in Krisenzeiten immer eine Möglichkeit war, Schuld zuzuweisen, Schuldige zu suchen oder sich zum Opfer zu stilisieren.“
Nora Goldenbogen
Nora Goldenbogen erlebt das in Dresden und Sachsen ganz anders: Wenn etwa deutsche Besucher in die Synagoge kommen und fragen, ob es denn für den Bau der Synagoge nicht genug jüdisches Geld gegeben habe. Juden und Geld. Juden als Strippenzieher. Solche Stereotype verfolgen sie seit Jahrzehnten. In den vergangenen Jahren ist es nach ihrer Überzeugung schlimmer geworden.
„Antisemitische Klischees gab es damals auch in den Köpfen der DDR-Bürger“, erinnert sie sich. Diese Klischees würden in den Familien weitergegeben. Im Osten ebenso wie im Westen. Sie hat gelernt, damit zu leben. Dennoch beunruhigt es sie, wie viele in der Pandemie bereit waren, sich mit einem gelben Ungeimpft-Stern mit NS-Opfern gleichzusetzen: „Das ist erschreckend.“ Krisen seien immer mit starker Verunsicherung verbunden. „Es ist eine historische Tatsache, dass Antisemitismus in Krisenzeiten immer eine Möglichkeit war, Schuld zuzuweisen, Schuldige zu suchen oder sich zum Opfer zu stilisieren“, sagt Goldenbogen. Und die Krisen nehmen anscheinend kein Ende: Corona, Klima, Krieg.
„Du Jude“ als Schimpfwort
Aus vielen Gesprächen in den sächsischen Gemeinden weiß sie, dass Judenfeindschaft längst nicht nur ein Problem von Ewiggestrigen aus der älteren Generation ist. „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr oft darüber gesprochen, dass Antisemitismus in den Schulen normal geworden ist“, berichtet Goldenbogen. Auf Schulhöfen ist die Phrase „Du Jude“ vielerorts eine gängige Schmähung geworden. Viele Lehrer seien nicht in der Lage, mit ihren Schülern darüber zu reden, geschweige denn das Klima in Klassen und Schulen zu verändern, kritisiert Goldenbogen. Seit Langem gibt es Pläne der Kultusministerkonferenz, Antisemitismus stärker als bisher in den Lehrplänen zu verankern. Doch umgesetzt wurden diese bislang nicht.
Vorurteile und Anfeindungen im Alltag kennen auch ihre sächsischen Gemeindemitglieder, berichtet Nora Goldenbogen: „Ein großer Teil lebt sein Judentum ziemlich zurückgezogen.“ Sie weiß aus Gesprächen, dass private Konflikte zwischen Nachbarn mitunter eskalieren, wenn jemand plötzlich äußert: typisch Jude. Dann werden in einem bis dahin alltäglichen Streit um Banalitäten auf einmal antisemitische Klischees verwendet. „Das ist ziemlich schwer auszuhalten“, sagt sie.
5) Spucken, drohen, schlagen
Bianca Loy arbeitet als Referentin für die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) in Berlin, die mit ihrem Monitoring maßgeblich dazu beitragen, ein genaues Bild vom Ausmaß antisemitischer Anfeindungen und Übergriffe zu gewinnen. Sie weist darauf hin, dass es im vergangenen Jahr durchschnittlich fast sieben antisemitische Vorfälle pro Tag gab. Darunter auch mit neun Fällen einen neuen Höchststand bei extremer antisemitischer Gewalt: „Das ist eine neue qualitative Dimension antisemitischer Vorfälle.“ Wobei von einem großen Dunkelfeld auszugehen ist, weil viele Betroffene antisemitische Erlebnisse erfahrungsgemäß selten melden oder gar anzeigen. Loy betont den alltagsprägenden Charakter der Übergriffe. Sie ereigneten sich „beim Einkaufen oder im eigenen Wohnumfeld“. Das macht es für Betroffene so gefährlich und traumatisierend. Denn man kann Anfeindungen, Bedrohungen und Gewalt nicht aus dem Weg gehen, wenn sie sich in der Nachbarschaft, der Schule oder im Supermarkt um die Ecke ereignen.
Neuer Höchststand bei extremer antisemitischer Gewalt
Loy berichtet von einem jüdischen Mann, der mit einem Freund ein Café in Hamburg besucht hat und eine Kippa trug, woraufhin er von der Bedienung zu hören bekam: „Ja, dass er Geld hat, sieht man schon an der Mütze. Die haben immer genug Geld.“ In einem anderen Fall wurde ein erkennbar jüdisches Paar im Auto bis auf einen Parkplatz verfolgt und von einem anderen Fahrzeug ausgebremst. Dort schlugen dann drei Männer gegen das Auto, bespuckten die Fenster, beleidigten ihre Opfer antisemitisch und drohten ihnen Gewalt an. Das Spektrum von alltäglichem Antisemitismus reicht von Vorurteilen über das Absprechen der Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft (sog. „Othering“) und Drohungen bis zu offener Gewalt.
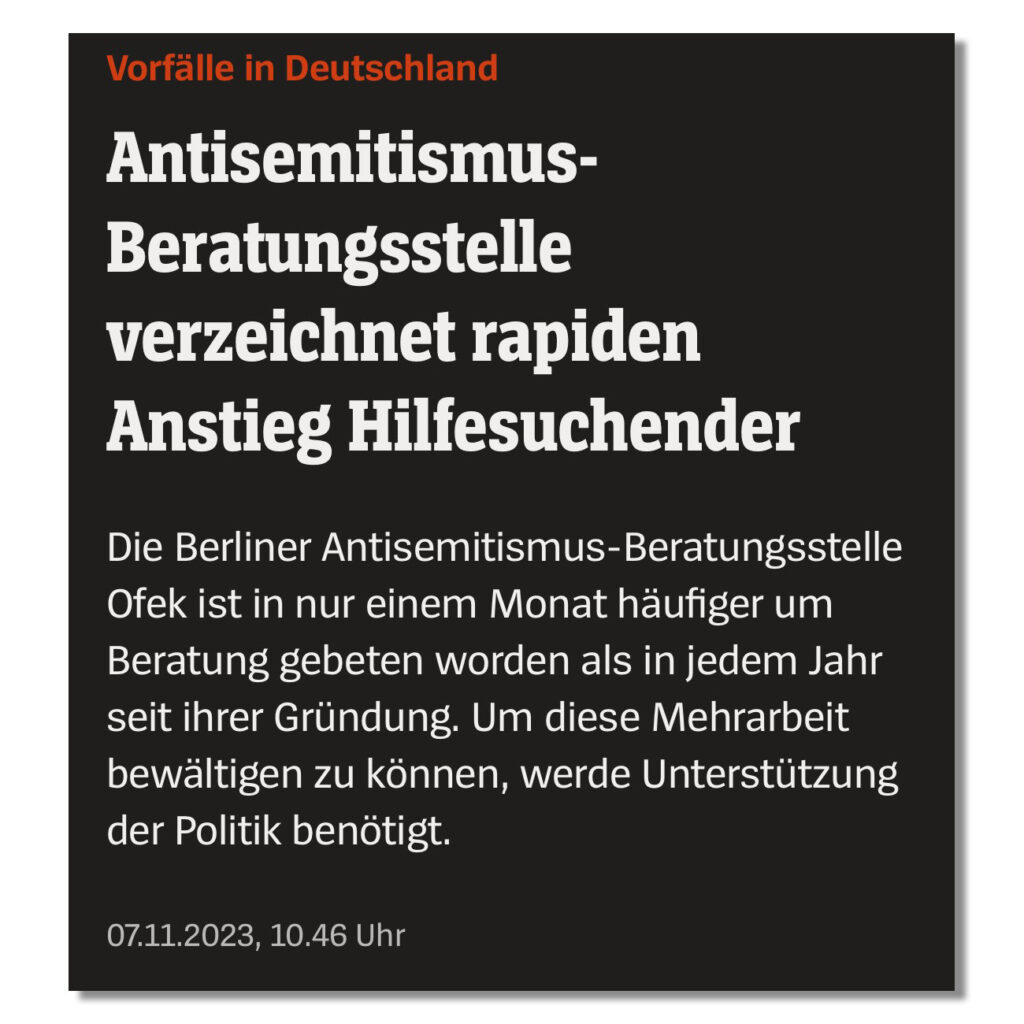
Nach den Angriffen der Hamas auf Israel haben in Deutschland deutlich mehr Betroffene Unterstützung bei OFEK gesucht. (Spiegel, Artikel vom 7. November 2023)
Immer wieder beklagen Betroffene, von den Sicherheitsbehörden nicht ernstgenommen zu werden. Insbesondere wird Antisemitismus im Rahmen einer Strafverfolgung nicht immer als Tatmotiv anerkannt. Bianca Loy bemerkt zwar durchaus Fortschritte. So sei es ein erster wichtiger Schritt, dass einzelne Beamtinnen und Beamte in den zuständigen Staatsschutzabteilungen der Polizei inzwischen im Umgang mit Antisemitismus geschult seien. Darüber hinaus brauche es aber „eine Sensibilisierung in der Breite der Polizeibehörden“. RIAS sehe weiterhin großen Bedarf, „die Betroffenenperspektive ernstzunehmen und einzubeziehen; das gilt im Besonderen für die Strafverfolgungsbehörden.
Dafür ist zentral, dass ein Verständnis für Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen vorhanden ist und den Betroffenen Sensibilität entgegengebracht wird.“ So müsse auf Seiten der Staatsanwaltschaften die Würdigung einer antisemitischen Motivlage in Strafverfahren zu einem zentralen Thema werden. Antisemitismus wird oft nur dann eindeutig erkannt und geahndet, wenn es bei einer Tat einen direkten Bezug zu NS-Symbolen oder Parolen gibt. Die Erfahrungen aus der Praxis sprechen dafür, den Umgang mit modernem Antisemitismus sehr viel stärker und systematischer in Aus- und Fortbildungen zu verankern. Viele Institutionen stehen da erst am Anfang, wie Fachleute aus der Praxis politischer Bildungsarbeit übereinstimmend berichten.
6) Antisemitismus in der politischen Kultur
Politisch leistet die AfD dem Antisemitismus systematisch Vorschub. Nicht nur, indem deren Personal mit antisemitischen Codes über „globalistische Eliten“ raunt. Der Begriff „Globalisten“ gilt als ein Synonym für Juden, die in Verschwörungserzählungen als vermeintlich wurzellose, über die Welt verteilte Zerstörer gewachsener Völker und Kulturen angesehen werden. Darüber hinaus greift die AfD offen die deutsche Erinnerungskultur an. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke hat das Holocaust-Mahnmal in Berlin ein „Denkmal der Schande“ genannt und eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ gefordert. AfD-Politiker verhöhnen das rituelle Gedenken an die Opfer der Shoah als „Schuldkult“. Auschwitz soll als zentraler Fixpunkt deutscher Erinnerungskultur beseitigt werden, um wieder ungestört von deutscher Schuld völkische Ideologie propagieren zu können.
Jens-Christian Wagner, Stiftungsdirektor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, warnt vor einem „erinnerungspolitischen Klimawandel“ im Land. Der politische Geschichtsrevisionismus bleibt derweil nicht folgenlos. Seit einiger Zeit registrieren NS-Gedenkstätten eine Zunahme rechtsextremer Vorfälle. Gedenkorte für Nazi-Opfer werden mit Propaganda-Parolen und Hakenkreuzen geschändet.

Hubert Aiwanger. Foto: Lennart Preiss/dpa
Der Fall Aiwanger
Auftrieb erhalten rechte Täter auch durch öffentliche Debatten wie im Fall des Freie-Wähler-Politikers Hubert Aiwanger, bei dem zu dessen Schulzeiten eine antisemitische Hetzschrift gefunden worden war. Bianca Loy von RIAS kritisiert, dass in der Debatte um den bayerischen Politiker eine „Abwehr der Erinnerung an die Shoah“ erfolgt sei und „jegliche Verantwortung zurückgewiesen wurde“. Im Gegenteil stilisierte sich der Chef der Freien Wähler in Bayern in Bierzelten lautstark als Opfer einer medialen und politischen „Schmutzkampagne“. Der Antisemitismusbeauftragte des Bundes, Felix Klein, sagt: „Aus meiner Sicht hat diese Angelegenheit dem Kampf gegen Antisemitismus in diesem Land geschadet.“ Er appelliert, nicht zuzulassen, dass der Kampf gegen Antisemitismus lediglich als Teil des politischen Geschäfts wahrgenommen werde. Die politische Kultur entscheidet maßgeblich darüber, wie wirkmächtig Judenfeindschaft in der Gesellschaft werden kann. Ob diese Menschenverachtung stillschweigend geduldet oder im Gegenteil konsequent tabuisiert und ausgegrenzt wird.
Judenwitze im Abendprogramm
Ein weitverbreiteter Irrtum besteht darin, Antisemitismus nur als Problem von Jüdinnen und Juden misszuverstehen. Er ist aber vielmehr Ausdruck eines Demokratieproblems, das alle angeht, weil er die Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens zerstört. Darum sind Bianca Loy zufolge auch alle in der Gesellschaft gefragt, „jede Form von Antisemitismus zu ächten“. Damit tut sich die deutsche Gesellschaft allerdings regelmäßig schwer. Das war bei antisemitischer Kunst auf der Kunstschau Documenta so und auch, nachdem die Kabarettistin Lisa Eckhart im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Judenwitze erzählt hat.
Zuletzt fiel Fernsehphilosoph Richard David Precht in einem Podcast mit dem Talkmaster Markus Lanz mit antisemitischen Stereotypen über orthodoxe Juden auf, denen die jüdische Religion angeblich zu arbeiten verbiete, mit Ausnahme von „ein paar Sachen wie Diamanthandel“ und „Finanzgeschäfte“. Nach heftiger öffentlicher Kritik ruderten Precht und das ZDF zurück. Precht räumte später seine falsche Aussage ein. Bezeichnenderweise entschuldigte er sich aber lediglich bei jenen, deren „religiöse Gefühle“ er verletzt habe oder „die das an antisemitische Klischees erinnert hat“. Das ZDF sprach auch nur davon, dass Prechts Darstellung „missverständlich interpretiert werden konnte“.
Wo ist die Solidarität, wenn es drauf ankommt?
Dagegen kritisiert Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter von Baden-Württemberg, in einem Faktencheck, in dem Podcast seien „reihenweise Falschbehauptungen“ über das Judentum verbreitet worden. So würden gläubige Juden keineswegs wie behauptet „den ganzen Tag beten“, sondern dreimal am Tag. Blume kritisierte auch die Aussage von Lanz über angebliche „Mächte und Kräfte“, die ein großes Interesse daran haben, einen streng gläubigen Menschen „emotional einzukesseln“ und „fast als Geisel zu nehmen“. Blume erkennt in diesen unbedachten Äußerungen „antisemitische Verschwörungsmythen“. In den deutschen Debatten zum Thema ist derartige, auf Sachkenntnis beruhende Kritik selten.
Ebenso die Erkenntnis, dass sich auch ansonsten aufgeklärte Menschen antisemitisch äußern können. In vielen Medien ist oft nur vom Vorwurf des Antisemitismus die Rede, ohne diesen inhaltlich zu prüfen und zu werten. Die vielbeschworene Solidarität mit Jüdinnen und Juden – im Alltag lässt sie gerade dann zu wünschen übrig, wenn es drauf ankommt. Auch weil es in allen gesellschaftlichen Bereichen an Wissen über Antisemitismus fehlt.

„Das war eine zusätzliche Belastung“
Max Privorozki ist Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Halle an der Saale und hat den Terroranschlag auf die Synagoge im Oktober 2019 überlebt. Im Interview spricht er über seine Erfahrungen mit Journalistinnen und Journalisten nach der Tat.
Der beeindruckende Appell von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) gegen jeden Antisemitismus und für Solidarität mit Israel ist eine seltene Ausnahme im deutschen Diskurs. Dessen Videobotschaft, die lagerübergreifend auf große Resonanz stieß, drückt nicht nur eine unmissverständliche Haltung aus, sondern erklärt auch, dass die mantrahaft beschworene Formel „Nie wieder“, die zur deutschen Staatsräson wurde, mehr sein muss als eine bloße Behauptung: nämlich die konkrete Verpflichtung, im Hier und Jetzt entsprechend zu handeln.
Der Minister blendet dabei nichts aus. Weder das unermessliche Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung noch die Pflicht von Migrantinnen und Migranten in Deutschland, auch den gesellschaftlichen Grundkonsens einzuhalten, wonach Antisemitismus unter keinen Umständen geduldet wird. Habeck hat damit an ein deutsches Selbstverständnis erinnert, das an Gedenktagen regelmäßig beschworen wird, bevor das Land dann am nächsten Tag wieder zu einer weit weniger idealen Tagesordnung übergeht.
Am 27. Januar, dem sogenannten Holocaustgedenktag, oder in Reden anlässlich der Reichspogromnacht am 9. November heißt es immer wieder, dass jüdisches Leben selbstverständlich zu Deutschland gehöre. Aber die Realität sieht vielerorts anders aus. Jüdinnen und Juden sowie jüdische Einrichtungen müssen permanent vor Gewalt und Terror geschützt werden. Im Alltag wird Antisemitismus zu oft entweder nicht erkannt, ignoriert oder sogar geduldet. Das darf nicht so bleiben.
Ähnliche Beiträge

Im Kampfgebiet Lokalpolitik
2017 wird Bürgermeister Andreas Hollstein in Altena mit einem Messer attackiert - Gipfel einer langsamen Entwicklung.

Wie KI den Hass im Netz bekämpft
Ist künstliche Intelligenz (KI) das Mittel gegen Hass und Hetze im Internet? Offizielle Meldestellen wie die Landesmedienanstalten oder „Hessen gegen Hetze“ nutzen seit Jahren smarte Technologien.

Kampf gegen Hass auf der Straße und im Netz
Die Angriffe gegen queere Menschen nehmen weiter zu - und kommen aus mehreren Richtungen.


Teile diesen Beitrag per: