Täterin aus Versehen
Eine Frau fällt auf Job-Scamming herein – und macht sich selbst strafbar. Ein vermeintlicher Nebenjob endete für die 50-Jährige mit Ermittlungen gegen sie.
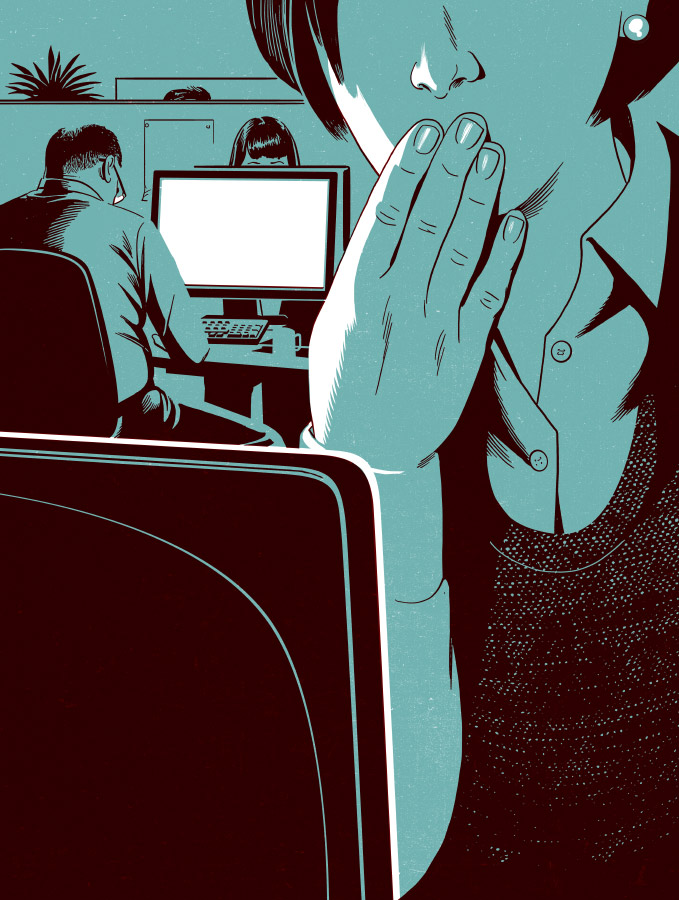
Dutzende Menschen sind jährlich von Job-Scamming betroffen.
Manuela Ahler (Name geändert) wollte sich schon länger etwas Geld dazuverdienen. Die 50-Jährige aus dem oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist alleinerziehend, ihre beiden Kinder sind 15 und 19. Eigentlich ist sie gelernte Großund Außenhandelskauffrau, arbeitet aber als persönliche Assistentin für eine Frau mit Behinderung. Im Frühjahr 2024 habe sie online nach Aufstockungsmöglichkeiten gesucht und auf einer renommierten Job-Plattform die Annonce einer IT-Firma aus dem benachbarten Landkreis Miesbach entdeckt.
Das Unternehmen habe freiberufliche Mitarbeiter gesucht, die von zu Hause aus Webseiten und Apps testen. Die Firmenwebseite habe seriös gewirkt. „Für mich gab es keinen Anlass, an der Glaubwürdigkeit zu zweifeln“, sagt Ahler. An einem Montagnachmittag im Mai sitzt sie in einem Biergarten in der Nähe ihres Wohnorts und erzählt gefasst von der Betrugsmasche, auf die sie hereingefallen sei. Neben ihr hat Andrea Dechamps Platz genommen, ihre Betreuerin vom WEISSEN RING, die gemeinsam mit ihr das vergangene Jahr rekonstruiert.
Über die falsche Webseite wurden Waren verkauft, die es nicht gibt
Im Frühjahr 2024 erhielt Ahler demnach von ihrem neuen Auftraggeber einen Arbeitsvertrag per Mail. Ihre Aufgabe: Sie sollte bei verschiedenen Banken Konten eröffnen – „Testkonten“, versicherte man ihr – und den Service bewerten, zum Beispiel die Freundlichkeit und Schnelligkeit der Mitarbeitenden. Danach würde ihr Auftraggeber die Demo-Accounts löschen.
Um bei den Kontoeröffnungen ihre Identität zu bestätigen, musste Ahler ein Foto von sich mit ihrem Personalausweis hochladen. Das sogenannte Video-Ident-Verfahren ist bei Online-Vertragsabschlüssen üblich. Allerdings habe Ahler, das betont sie mehrmals im Gespräch, zu keiner Zeit eigenständig Zugriff auf die Konten gehabt. Im Auftrag der Firma habe sie Identcheck-Apps getestet, die man fürs Online-Banking braucht. Die gesamte Kommunikation sei über Chats gelaufen, sagt sie. Vier Monate lang sei das „gut gegangen“.
Etwa zehn vermeintliche Test-Konten hat Ahler nach eigenen Angaben innerhalb von vier Monaten eröffnet und dafür rund 100 Euro im Monat auf ihr privates Konto erhalten, bis irgendwann keine Aufträge mehr gekommen seien.
Am 28. August 2024, Ahler erinnert sich an das genaue Datum, fand sie einen Kontoauszug in der Post. Das dazugehörige Konto habe nicht ihr gehört. „Da waren Geldeingänge von einem Dutzend verschiedener Namen aufgelistet, die ich nicht kannte“, erzählt sie. Mal seien 30, mal 300 Euro eingegangen, insgesamt rund 20.000 Euro, die wiederum auf ein ihr unbekanntes Konto überwiesen worden seien. „Als ich den Kontoauszug sah, dachte ich zum ersten Mal, dass da etwas nicht stimmt.“
Ahler telefonierte alle Nummern durch, die sie von der Firma – ihrem angeblichen Arbeitgeber – im Internet fand. Als sie endlich jemanden erreichte, wusste man dort schon Bescheid: Die Webseite der Firma sei „geklont“ worden, sagte man ihr.
Eine virtuelle Kopie sei für eine Betrugsmasche benutzt worden. Über die falsche Webseite wurden Waren verkauft, die es nicht gibt. Das Geld, das die Kunden dafür überwiesen haben, ist verschwunden. Sie sei, sagte man ihr noch, nicht die Erste, die sich bei der Firma beschwere.
Dem WEISSER RING Magazin ist der Name des Unternehmens bekannt. Auf Anfrage berichtet der Gründer und Geschäftsführer, dass auch er Anzeige erstattet habe. In seinem Namen seien Verträge erstellt und Menschen hereingelegt worden. Er wisse von mindestens sieben Opfern, die sich bei ihm gemeldet hätten. Der Aufwand, mit Betroffenen zu kommunizieren und die Fake-Webseite und -Stellenanzeigen löschen zu lassen, sei immens gewesen. Er habe auch Mahnungen erhalten für Print-Stellenanzeigen, die in seinem Namen geschaltet worden seien. Damals hatte er das Unternehmen gerade neu gegründet. „Das schadet natürlich dem Ruf meiner Firma, die sich um IT-Sicherheit kümmert“, sagt er. Die Betrüger seien nicht gefasst, das Verfahren sei bereits eingestellt worden.
Was ihm und Ahler passiert ist, hat System.
24%
der Verbraucher in Deutschland sind schon einmal Opfer von Online-Betrug geworden. Das Ergab eine SCHUFA-Umfrage zu Online-Betrug.
61%
haben dadurch einen finanziellen Schaden erlitten.
10%
der Verbraucher haben Angst, auf Online-Betrug hereinzufallen.
In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „YouGov“ gaben elf Prozent der mehr als 2.000 Befragten an, dass sie schon einmal Opfer von Identitätsdiebstahl im Internet geworden sind. Beim sogenannten Job-Scamming nutzen Betrüger Marktforschungsaufträge und Jobanzeigen, um an persönliche Daten, zum Beispiel Ausweisdokumente, zu kommen, die man für Video-Ident-Verfahren braucht. Damit werden unter anderem Konten eröffnet und diese zur Geldwäsche benutzt. Oft sehen die Internetauftritte so professionell aus, dass man keinen Verdacht schöpft, oder es werden Namen und Webseiten von real existierenden Firmen kopiert.
Dem Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland zufolge nutzen Betrüger auch WhatsApp- und Telegram- Gruppen für Job-Scamming. Dort schwärmen angebliche Nutzerinnen und Nutzer von den Verdienstmöglichkeiten von mehreren Hundert Euro am Tag. Vielen Opfern entsteht dadurch auch ein finanzieller Schaden. Die Verbraucherzentrale Hessen rät darum, auf keinen Fall Konten einzurichten, deren Zweck unklar ist, oder persönliche Daten preiszugeben. Bei Verdacht kontaktiert man am besten Polizei, Bank und Schufa.
„Immer wenn der Postbote klingelt oder ich in den Briefkasten schaue, frage ich mich, ob ich gleich wieder schlechte Nachrichten bekomme.“
Manuela Ahler
Auch bei Manuela Ahler wurden die angeblichen Testkonten offenbar für kriminelle Geschäfte genutzt. Das erfuhr sie, als sie Anzeige bei der Polizeiinspektion Wolfratshausen erstattete – und auch, dass sie ebenfalls belangt werden kann. „Ich bin erst einmal erschrocken, davor hatte ich noch nie etwas mit der Polizei zu tun“, sagt Ahler. Nun eröffneten ihr die Beamten, dass sie auch gegen sie ermitteln werden, weil sie Beihilfe zu Betrug und Geldwäsche geleistet habe, unwissentlich zwar – „doch das schützt bekanntlich nicht vor Strafe“, sagt ihre Betreuerin Andrea Dechamps.
Dechamps arbeitet seit fünf Jahren als Ehrenamtliche für den WEISSEN RING. Online-Betrug begegnet den Betreuerinnen und Betreuern immer wieder. „Es kann wirklich jedem passieren“, sagt Dechamps. Eine Besonderheit für den WEISSEN RING ist, dass Ahler nicht nur Opfer ist, sondern selbst zur Täterin wurde. „Ich habe mich mit Frau Ahler getroffen und im Gespräch gemerkt, dass sie glaubwürdig und unverschuldet in diese Situation geraten ist.“
Die Beamten dagegen, so schildert es Ahler, hätten wenig Verständnis gezeigt: „Sie sagten, dass ich fahrlässig gehandelt habe. Das stimmt ja auch. Ich war gutgläubig, aber ich fühle mich selbst missbraucht – und als Opfer.“

Mein Vater, die Trickanrufer und ich
Jedes Jahr erbeuten Kriminelle mit Fake-Anrufen Millionen. Oft schüttelt man den Kopf, bis es einem selbst passiert.
Am Anfang, erzählt Ahler, habe sie kaum schlafen können und Angst gehabt, weil die Betrüger immer noch ihre persönlichen Daten hätten. Nachts habe sie Panikattacken gehabt. Heute sei sie „überkritisch“ und gehe nicht ans Telefon, wenn sie die Nummer auf dem Display nicht kennt.
Die Sache könnte Manuela Ahler noch viele Jahre, vielleicht ihr Leben lang begleiten
Nach der Anzeige wandte sie sich an den WEISSEN RING, der ihr daraufhin einen Gutschein für eine Erstberatung beim Rechtsanwalt ausstellte. Weitere Hilfen konnte der Verein nicht leisten. Inzwischen hat sie Post von drei Staatsanwaltschaften aus drei Bundesländern bekommen. „Die Käufer, die Waren bezahlt und nicht bekommen haben, kommen aus verschiedenen Regionen“, erklärt Dechamps. Die Staatsanwaltschaften informieren Ahler jeweils darüber, dass sie gegen sie ermitteln. Der letzte Brief kam vor ein paar Tagen aus Göttingen. „Pro Staatsanwaltschaft legt der Anwalt eine neue Akte an, das kostet jedes Mal 500 Euro“, sagt sie. Um Geld zu sparen, schreibt sie die Stellungnahmen inzwischen selbst. „Und ich weiß ja nicht, wie viel da noch auf mich zukommt, wie viele Betrugsopfer sich noch melden.“
Die Sache könnte Ahler noch viele Jahre, vielleicht ihr Leben lang begleiten. Denn da ist das Wissen: Für Beihilfe zur Geldwäsche reicht das Strafmaß von einer Geld- bis zu einer Haftstrafe. Was, wenn sie wirklich angeklagt wird? Ahler fühlt sich machtlos. „Für einen teuren Prozess fehlt mir das Geld“, sagt sie.
Bei einem Telefongespräch Ende Juli erzählt sie, dass die Staatsanwaltschaft Siegen das Ermittlungsverfahren gegen sie eingestellt habe. „Eine kleine Erleichterung“, sagt sie. Doch die Angst bleibt: „Immer wenn der Postbote klingelt oder ich in den Briefkasten schaue, frage ich mich, ob ich gleich wieder schlechte Nachrichten bekomme.“
Viele Betroffene schweigen in so einer Situation, aus Scham. „Es ist mir peinlich, dass ich so fahrlässig war“, sagt Ahler. „Aber ich erzähle trotzdem allen davon, die ich kenne.“
Sie wolle ihre Geschichte teilen, um andere zu warnen. Einen Nebenjob hat sie inzwischen auch gefunden, ganz analog: Gemeinsam mit ihrem Sohn trägt sie Zeitungen aus.
Transparenzhinweis:
Laut Satzung darf der WEISSE RING ausschließlich Menschen helfen, die Opfer einer Straftat geworden sind. Manuela Ahler (Name geändert) ist aber Täterin geworden, daher kann der Verein an dieser Stelle keine weitere Unterstützung anbieten. Dennoch erkennt der WEISSE RING die gesellschaftliche Relevanz des Falls an und hat sich deshalb bewusst entschieden, die Geschichte öffentlich zu machen.
Ähnliche Beiträge

Internet macht Schule
Wie kann man Kinder und junge Menschen auf die Herausforderungen im Netz vorbereiten, wie schützt man sie vor digitaler Gewalt? Auf der Suche nach Antworten in Hessen, Berlin und Brandenburg.

Polizeischutz für die Minderheiten
Was genau sind eigentlich Hassverbrechen? Wie lassen sie sich bekämpfen? Und was empfinden die Betroffenen? Eine Antwortsuche in München und Nürnberg.

Pornografisches im Posteingang
Studierende erleben an deutschen Hochschulen digitale Gewalt – per E-Mail, in sozialen Netzwerken und auf Lernplattformen im Internet. Drei junge Frauen wollen das ändern.

Teile diesen Beitrag per: