Eine Herzensangelegenheit
Mehr als 25 Jahre saß Barbara Richstein als Abgeordnete im Brandenburger Landtag, fast genauso lange ist sie Mitglied im WEISSEN RING. Im September 2024 wählten die Delegierten des Vereins sie zur neuen Bundesvorsitzenden. Was möchte sie in den kommenden zwei Jahren als oberste Opferschützerin bewegen? Ein Treffen in Berlin.

„Wir sind ein gutes Team“: Barbara Richstein mit Vorstandskollegen bei der Bundesdelegiertenversammlung 2024 in Frankfurt am Main.
An einem kühlen Oktobernachmittag tuckern Ausflugsdampfer auf der Spree durchs politische Berlin, Hauptstadttouristen machen Fotos vom Bundeskanzleramt. Am Ufer gegenüber liegt der „Zollpackhof“. Der Biergarten des Lokals ist verwaist, auf den Tischen sammelt sich buntes Herbstlaub. Der Internetseite des Restaurants zufolge befand sich hier um 1700 das erste Ausflugslokal Berlins. Heute werben die Betreiber mit der Berliner Tradition und schenken zwischen holzvertäfelten Wänden und blau-weißen Tischtüchern bayerisches Bier aus.
Barbara Richstein, 59 Jahre alt, Landesvorsitzende des WEISSEN RINGS in Brandenburg und seit knapp vier Wochen zudem neue Bundesvorsitzende des Vereins, hat den Treffpunkt aber nicht wegen der krachledernen Gemütlichkeit vorgeschlagen, sondern wegen der verkehrsgünstigen Lage in Berlin-Mitte.
Sie öffnet ihre Aktentasche und legt einen Stapel Papier aufs Tischtuch. Das, sagt sie, habe sie neulich beim Ausräumen in ihrem Büro gefunden: Kopien von Presseartikeln, erschienen im Jahr 2002, als Richstein Justizministerin in Brandenburg wurde. „Der Opferschutz soll verstärkt werden“, schrieb die „Lausitzer Rundschau“, der „Tagesspiegel“ zitierte groß: „Ein verstärkter Opferschutz liegt mir besonders am Herzen“. Barbara Richstein lächelt. „An der Aussage hat sich nichts verändert“, sagt sie heute, 22 Jahre später.
Seit 1999 saß die CDU-Politikerin aus Falkensee am Rande Berlins im Brandenburgischen Landtag, zuletzt als Vizepräsidentin des Potsdamer Hauses. Zur Landtagswahl im September 2024 ist die 59-Jährige nicht mehr angetreten. Nach 25 Jahren im Landtag ist für Richstein also Schluss in der Politik, oder wie sie sagt: „Ein neuer Lebensabschnitt beginnt.“

Barbara Richstein ist seit 2002 Mitglied im WEISSEN RING.
Lassen Sie uns raten, Frau Richstein: Sie sind mit dem Fahrrad da?
Nein. (Sie lacht.) Mit der Bahn, der Hauptbahnhof ist ja nur ein paar Hundert Meter entfernt von hier.
Bei Ihrer Vorstellung vor der Wahl zur Bundesvorsitzenden des WEISSEN RINGS wurde das augenzwinkernd als ausdrücklicher Vorteil der Kandidatin Richstein angepriesen: Sie könnten künftig jederzeit mit dem Fahrrad in die Hauptstadt radeln, um dort öffentliche Termine wahrzunehmen und Netzwerke zu knüpfen.
Das stimmt. Aber wissen Sie auch, woher die Fahrrad-Anspielung kam?
Nein. Verraten Sie es uns?
Im Sommer war ich mit einer Freundin auf einer Fahrradtour, so wie in jedem Jahr. Genau in diese Zeit fiel aber die digitale Sitzung des Geschäftsführenden Bundesvorstands des WEISSEN RINGS, bei der bekannt gegeben werden sollte, dass ich kandidieren werde. Eigentlich wollten wir bis zu der Sitzung eine Gaststätte erreicht haben, das hat aber nicht geklappt. So habe ich mich dann mit Fahrradhelm eingewählt. Unglücklicherweise war das in der Nähe von Wacken, wo gerade der erste Tag des berühmten Heavy-Metal-Festivals gefeiert wurde und die Musik entsprechend dröhnte. (Sie lacht.) Aber es hat dann ja doch alles geklappt.
Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie als Bundesvorsitzende kandidiert haben? Zunächst waren Sie als Versammlungsleiterin nominiert, nicht als Kandidatin für die Vereinsführung …
Das kam auch überraschend für mich. Patrick Liesching, der die vergangenen beiden Jahre der Bundesvorsitzende war, hat mich im Sommer in einem persönlichen Gespräch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, seine Aufgaben zu übernehmen. Ich empfand und empfinde es als eine große Auszeichnung, überhaupt gefragt zu werden, und es passte gut zusammen mit dem Ende eines Lebensabschnitts: Vor zwei Jahren hatte ich entschieden, dass ich nach 25 Jahren aus der Landespolitik ausscheide und mich neuen Aufgaben widmen möchte.
Allerdings bin ich auch Aufsichtsrätin beim Deutschen Leichtathletikverband. Deshalb musste ich erst mal abklären, ob meine Engagements für beide Seiten okay sind. Das passte, und das freut mich sehr, denn der WEISSE RING liegt mir schon seit über 20 Jahren am Herzen.
Was ändert sich im WEISSEN RING mit Barbara Richstein als Bundesvorsitzender?
Ich glaube, ich kann wunderbar anknüpfen an die gute Arbeit, die Patrick Liesching in den vergangenen beiden Jahren geleistet hat. Ich bin sehr glücklich, dass wir ihn überzeugen konnten, als Stellvertreter weiter dem Geschäftsführenden Bundesvorstand anzugehören.
Wir sind ein gutes Team in dem Gremium, und die Zusammenarbeit ist einfach schön. Ich werde das Rad auch nicht neu erfinden: „Digitale Gewalt“ wird uns weiter beschäftigen, das war 2024 das Jahresthema des WEISSEN RINGS, und das wird es auch im kommenden Jahr sein. Die Maschen der Betrüger im Digitalen werden immer raffinierter, deshalb ist Prävention in diesem Bereich so wichtig.
Der WEISSE RING hat aber auch viele andere Dinge angestoßen. Dazu gehört unser Anliegen, dass die Fußfessel-Überwachung nach dem spanischen Modell auch in Deutschland eingeführt wird, um Opfer häuslicher Gewalt besser zu schützen.
Haben Sie Hoffnung, dass das spanische Modell zeitnah kommt?
Um ganz ehrlich zu sein: In dieser Legislaturperiode, in der keiner weiß, wie lange die überhaupt noch bestehen wird, glaube ich da eher nicht dran.
Was Barbara Richstein zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen kann: Zwei Wochen nach unserem Gespräch wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Finanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen – das Ende der Ampelkoalition. Auch FDP-Justizminister Marco Buschmann, der einer bundesrechtlichen Fußfessel-Regelung ablehnend gegenüberstand, tritt zurück. Neuwahlen sollen Ende Februar stattfinden.
Ich habe aber die Hoffnung, dass eine neue Bundesregierung das spanische Modell in der kommenden Legislaturperiode auf den Weg bringt. Das wird auch Zeit, denn jeder Tag ohne die Verschärfung des Gewaltschutzgesetzes ist für die Betroffenen einer zu viel.
,,Wir müssen noch lauter werden und die Probleme im Opferschutz klar als solche benennen, den Finger in die Wunde legen."
Barbara Richstein
Im Frühjahr 2024 haben Sie, damals noch als designierte Versammlungsleiterin, einen Fragebogen für unser Magazin ausgefüllt. Darin sagten Sie, der WEISSE RING müsse insbesondere in den neuen Bundesländern noch bekannter werden. Wie wollen Sie das als Bundesvorsitzende anstellen?
Der WEISSE RING war in der Vergangenheit sehr westdeutsch orientiert. Das fängt bei den Gremienbesetzungen an und reicht bis zu Seminarinhalten, in denen die meisten Fallbeispiele aus den alten Bundesländern stammen.
Generell ist Diversität wichtig, auf allen Ebenen. Und natürlich eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Wir müssen noch lauter werden und die Probleme im Opferschutz klar als solche benennen, den Finger in die Wunde legen. Dass das klappen kann, zeigen die zahlreichen Reaktionen zu unserem Einsatz für das spanische Modell bei der Fußfessel.
Der Verein muss aber nicht nur in Ostdeutschland bekannter werden, sondern bundesweit – vor allem bei den jüngeren Menschen. Ich war Mitte Oktober beim Dialogforum, einem Treffen der Jungen Mitarbeitenden des Vereins aus ganz Deutschland. Viele von denen haben mir gesagt: „Uns kennt keiner“. Die „Generation Eduard Zimmermann“ um den Mitbegründer des WEISSEN RINGS, der durch die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ so etwas wie eine Institution war, wird eben immer kleiner.
Die Bundesdelegiertenversammlung des WEISSEN RINGS, die Sie zur Bundesvorsitzenden gewählt hat, hat auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss verabschiedet, der den Verein vor einer möglichen Unterwanderung durch extremistische Kräfte schützen soll. In einigen Regionen der neuen Bundesländer erreichte die in Teilen rechtsextreme AfD bis zu 40 Prozent der Wähler, auch bei Ihnen in Brandenburg kam die Partei auf knapp 30 Prozent. Erschwert so ein Unvereinbarkeitsbeschluss Ihren Plan, den WEISSEN RING „ostdeutscher“ zu machen?
Die Gefahr von Unterwanderung durch Extremisten – und damit meine ich nicht nur durch Parteien, sondern auch Menschen mit einer solchen Weltanschauung – ist schon sehr groß. Der Beschluss ist inhaltlich ja auch nicht ganz neu: Schon 2018 haben wir uns von Extremisten klar distanziert, nun ist das auch in unserer Satzung verankert.
Ich glaube, da sind die Deutschen ein bisschen feinfühliger geworden und verstehen, warum wir uns so positionieren müssen. Es ist daher folgerichtig, dass der Beschluss bei der Delegiertenversammlung in Frankfurt fast einstimmig beschlossen wurde. Das ist ein gutes Zeichen. Der WEISSE RING ist keinesfalls unpolitisch, aber er ist überparteilich.

Im Gespräch: Barbara Richstein beim Interviewtermin im „Zollpackhof“ in Berlin.
Im Jahr 2018 distanzierte sich der WEISSE RING von extremistischen Strömungen und Parteien. Der Bundesvorstand verurteilte damals Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit aufs Schärfste und beschloss einstimmig, dass sich der Verein nicht von extremistischen Parteien instrumentalisieren lässt und keine Spenden von der AfD annimmt. Auslöser war die missbräuchliche Verwendung des Logos des WEISSEN RINGS bei einer öffentlichen Spendensammlung durch einen Ortsverband der AfD in Nordrhein-Westfalen. Nach der Veröffentlichung des Vorstandsbeschlusses im Magazin des WEISSEN RINGS erklärten ein paar Dutzend Vereinsmitglieder ihren Austritt.
Sie waren lange im Brandenburgischen Landtag. Wie haben Sie die AfD dort erlebt?
In den letzten Jahren ist der Umgangston rauer geworden, das merken wir in der Gesellschaft, wir merken es aber natürlich auch in der Politik. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen sich gegenseitig weniger zuhören, sondern viele sich nur noch auf das Kontra, auf die eigene Gegenposition konzentrieren. Das liegt aber nicht nur an der AfD, muss man ehrlicherweise sagen.
Die Brandenburger AfD wird derzeit vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet, aber einige ihrer Abgeordneten gelten bereits als gesichert rechtsextrem. Es wurde in den Debatten schon deutlich, dass einige von denen eine völkisch-nationale Einstellung haben. Egal, welches Thema diskutiert wurde, sie haben immer wieder die Schleife bekommen, gegen Migranten zu hetzen und gegen andere, die nicht in ihr Weltbild passen.
Waren Sie als CDU-Politikerin Hass und Hetze ausgesetzt?
Hm. (Sie überlegt kurz.) In den 25 Jahren habe ich nur ein- oder zweimal einen unschönen Brief bekommen. Ich habe immer versucht, andere nicht persönlich anzugreifen und nicht zu stark zu polarisieren. Das ist nicht meine Klaviatur und hat mir bei der Arbeit, vor allem als Vizepräsidentin des Landtags, sehr geholfen. Ein Kollege von der Opposition hat mir mal gesagt: „Sie sind zu allen gleich streng.“ Das galt auch für meine eigene Fraktion.
Viele Politikerinnen und Politiker berichten von massiver analoger und digitaler Gewalt, zunehmend auch im kommunalen Bereich. In der Stadt Neubrandenburg hat jüngst ein Bürgermeister aus diesem Grund sein Amt niedergelegt. Was kann, was muss der Staat tun, um diese Menschen und ihre Ämter besser zu schützen?
Es ist ja schon einiges geschehen. Erst im Sommer hat die „Starke Stelle“ ihre Arbeit aufgenommen, das ist eine bundesweite Ansprechstelle für kommunale Amts- und Mandatsträgerinnen und -träger. Betroffene Politiker können sich dort individuell beraten lassen. In Brandenburg gibt es außerdem ein mobiles Beratungsteam: Als in meiner Kommune eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden sollte, gab es viel Widerstand. Das Beratungsteam hat dann alle an einen runden Tisch geholt und dazu eingeladen, sachlich miteinander zu reden.
Das Innenministerium in Brandenburg hat zudem eine Umfrage unter kommunalen Mandatsträgern gemacht, um faktenbasiert herauszufinden, wie viel Gewalt die wirklich erleben – und von wem sie angegriffen werden. Spannenderweise sind es manchmal nicht nur die Bürger, die Politiker bedrohen, sondern auch Kollegen aus den eigenen oder anderen Fraktionen.
Was kann, was muss eine Opferschutzorganisation wie der WEISSE RING tun, um Politikerinnen und Politiker zu schützen?
Im Bereich der Politik geht es oft um verbale Taten, körperliche Angriffe sind zum Glück eher die Ausnahme. Viele, die im Netz angegriffen werden, möchten vor allem geschützt werden. Es ist aber nicht immer leicht zu sagen, ab wann eine Aussage justiziabel ist und wann nicht. Das können wir auch nicht entscheiden. Der WEISSE RING versteht sich als Lotse im Hilfesystem, und dazu gehört, auf Angebote wie die „Starke Stelle“ zu verweisen, deren Netzwerkpartner wir auch sind. Außerdem gibt es noch spezialisierte Institutionen wie HateAid, die sehr erfahren sind im Umgang mit digitaler Gewalt und Betroffenen gut helfen können.
Wäre es ein hilfreiches Mittel gegen digitale Gewalt, wenn jeder sich nur noch mit dem Klarnamen im Internet anmelden dürfte?
Das würde ich mir wünschen. Ich glaube aber, dafür ist es schon zu spät, das haben wir verpasst. Bei unserer Bundesdelegiertenversammlung im September hat der Faktenchecker Oliver Klein vom ZDF über Hass im Netz berichtet und gesagt: „Die Lüge ist dreimal um die Welt, bevor die Wahrheit ihre Schuhe angezogen hat.“ Ich fürchte, wir werden das Problem nicht von heute auf morgen in den Griff bekommen. Deshalb ist es wichtig, auf Prävention zu setzen, vor allem bei der jüngeren Generation, die ja schon ganz anders mit digitalen Medien aufwächst.
Digitale Gewalt ist ein recht junges Tatphänomen. Meinten Sie das, als Sie vor Ihrer Wahl ankündigten, der WEISSE RING müsse sich stärker auf neue Deliktphänomene einstellen?
Ja, neben der Verrohung und Gewalt im Netz gehören auch die moderne Form des Enkeltricks, Phishing-Mails und KI-gesteuerte Betrugsmaschen dazu. Ich habe neulich erst eine SMS bekommen: „Hallo Papa, ich habe eine neue Telefonnummer.“ Da dachte ich: „Sehr schön, jetzt bin ich plötzlich Papa.“ Das ist natürlich eine offensichtliche Betrugsmasche, aber die Menschen müssen auch wissen, dass Banken keine unseriösen E-Mails schreiben und dass Polizisten zu Hause keine Wertsachen oder vermeintliches Falschgeld sicherstellen. Prävention ist nicht ohne Grund ein Satzungsziel des WEISSEN RINGS.
Neu ist auch das Sozialgesetzbuch 14 (SGB XIV), das im Januar 2024 das bisherige Opferentschädigungsgesetz abgelöst hat. Der WEISSE RING hat ja wiederholt auf Missstände beim alten OEG hingewiesen. Sehen Sie bereits Verbesserungen für die Opfer?
Das Gute ist: Der Katalog nach dem SGB XIV ist größer geworden. Theoretisch können Betroffene von Gewalttaten nun höhere Entschädigungen erhalten. Das Problem ist aber nach wie vor, dass die Opfer dafür oft immer noch zu einem Gutachter müssen, was wieder zu Retraumatisierungen führen kann.
Wir haben bislang den Eindruck, dass die Versorgungsämter seit der Umstellung des OEG auf das SGB XIV vor allem mit sich selbst beschäftigt sind.
Ich glaube, die Umstellung braucht noch ein bisschen Zeit. Das ist ein behördeninternes Verfahren und betrifft die gänzliche Umstellung der IT.
Wie sieht denn derzeit das Verhältnis zu den Landessozialämtern aus?
Nach der Veröffentlichung unserer Recherche „Tatort Amtsstube“ in unserem Magazin vor zwei Jahren, in der wir Missstände bei der Umsetzung des damaligen Opferentschädigungsgesetzes veröffentlicht haben: eher holprig. (Sie lacht.)
Es gibt aber viele Bemühungen, die Zusammenarbeit mit den Landessozialämtern zu verbessern und uns besser zu verknüpfen. Wir haben in Brandenburg und auch in anderen Bundesländern zum Beispiel unsere Außenstellen mit den Mitarbeitern der Behörden zusammengebracht, sodass jeder auch auf Augenhöhe sieht, wer da eigentlich mit wem zu tun hat.
Im nächsten Jahr soll es weitere Treffen auf regionaler Ebene geben, um zu schauen, ob sich für die Opfer qualitativ etwas an der Arbeit geändert hat.
Stichwort Opfer: In Frankreich findet zurzeit ein aufsehenerregender Vergewaltigungsprozess statt. Die Betroffene, Gisèle Pelicot, möchte, dass das, was sie erlebt hat, öffentlich diskutiert und gezeigt wird. Sie machte Schlagzeilen mit dem Satz: „Die Scham muss die Seite wechseln!“ Verfolgen Sie den Fall?
Das ist ein sehr krasser Fall. Ich finde, diese Frau ist sehr mutig, und es ist bemerkenswert, dass sie die Scham nicht annimmt. Ich hoffe, dass sie ein Vorbild für andere betroffene Frauen sein kann und sie ermutigt, selbstbewusst zu sagen: „Ja, ich bin vergewaltigt worden, aber es war definitiv nicht meine Schuld!“
Meinen Sie, dass sich durch den Prozess auch das Opferbild in Deutschland nachhaltig ändern kann?
Ich hoffe es sehr. Es herrscht bei einigen Menschen leider immer noch das Stereotyp, Betroffene seien selbst schuld, weil sie zum Beispiel das falsche Kleid getragen haben. Auch Verteidiger arbeiten oft in diese Richtung. Da muss sich etwas ändern.
,,Die Ehrenamtlichen sind das Herzstück des WEISSEN RINGS."
Woran denken Sie da?
Dieses Jahr wollte das Europäische Parlament eine einheitliche Definition des Straftatbestands „Vergewaltigung“ festlegen, die in allen Mitgliedsstaaten gelten sollte. Das Vorhaben ist aber gescheitert, unter anderem an unserem Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP, weil er die Europäische Union aus formalen Gründen als nicht zuständig ansah. Die Begründung kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt auch Rechtsexperten, die das Gegenteil gesagt haben. Wir hätten da längst weiter sein können.
Den Plänen des Europäischen Parlaments zufolge sollte jegliche „Vornahme einer nicht-einvernehmlichen sexuellen Handlung an einer Frau“ als Vergewaltigung gelten, wobei „das Schweigen der Frau, ihre fehlende verbale oder körperliche Gegenwehr oder ihr früheres sexuelles Verhalten“ nicht als Zustimmung betrachtet werden dürften. Vereinfacht ausgedrückt: nur Ja heißt Ja. In manchen EU-Staaten, zum Beispiel in Schweden oder Spanien, ist diese Regelung bereits geltendes Recht. In Deutschland gilt seit einer Änderung des Sexualstrafrechts im Jahr 2016 hingegen das Prinzip „Nein heißt Nein“.
Wie geht es für Sie jetzt weiter? Nicht nur der WEISSE RING muss in Ostdeutschland bekannter werden – umgekehrt müssen Sie als Vorsitzende eines ostdeutschen Landesverbands vermutlich auch an Ihrer Bekanntheit auf Bundesebene arbeiten. Werden Sie in den nächsten Wochen nun Deutschland bereisen, um sich in allen 400 Außenstellen des Vereins vorzustellen?
Alle Außenstellen zu besuchen wird vermutlich etwas schwierig. (Sie lacht.) Aber beim Treffen der Jungen Mitarbeitenden war ich schon, auch bei den Zentralen Ehrenamtlichen Diensten, also beim Opfer-Telefon und bei der Onlineberatung des Vereins. Ich werde zu so vielen Landestagungen fahren wie möglich. Ich merke, dass die Leute enorm motiviert sind.
Die Ehrenamtlichen sind das Herzstück des WEISSEN RINGS, das habe ich auch bei der Vorstellung vor meiner Wahl gesagt.
Nach dem Interview brauchen wir noch ein paar Fotos. In einem Clubraum des „Zollpackhofs“ entdeckt Barbara Richstein eine Wand voller Wimpel und Embleme. Es sind die von Rotary-Clubs aus ganz Deutschland. Richstein lacht, dann zückt sie das Handy und macht mehrere Fotos. „Da bin ich auch Mitglied“, sagt sie. Was sie nicht sagt: Sie ist die Präsidentin ihres Rotary-Clubs in Falkensee. Auch das ist ein Ehrenamt.
Natürlich.
Ähnliche Beiträge

“Wir sind wieder da!“
Jahrelang gab es keine Außenstelle des WEISSEN RINGS im Kreis Ludwigsburg. Bis Sonja Beurer und Tanja Leonhard kamen. Sie bauten hier wieder ein starkes Team an Helfenden auf.

Die Kämpferin
Lena Weilbacher, stellvertretende Landesvorsitzende des WEISSEN RINGS Niedersachsen, spricht im Interview über zentrale Zukunftsfragen des Opferschutzes – und erklärt, warum sie als Anwältin keine Strafverteidigung mehr übernehmen würde.
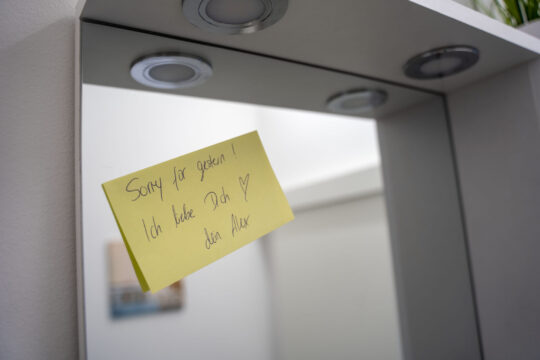
Das Unsichtbare sichtbar machen
Die Dauerausstellung „Wohnung Rosenstraße 76“ erzählt leise und eindrucksvoll von häuslicher Gewalt. Die Außenstelle Peine des WEISSEN RINGS hat sie besucht.

Teile diesen Beitrag per: