
Neue KFN-Studie erhellt Dunkelfeld. Foto: Christian J. Ahlers
Datum: 09.02.2024
So viele Männer sind Opfer von Partnerschaftsgewalt
Das Kriminalistische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) hat "Gewalt gegen Männer in Partnerschaften" erforscht. Die repräsentative Studie zeigt: Mehr als jeder zweite Mann in Deutschland ist in seinem Leben schon betroffen gewesen.
Mainz – Mehr als jeder zweite Mann in Deutschland ist in seinem Leben schon mal von Gewalt in der Partnerschaft betroffen gewesen. In rund 40 Prozent der Fälle handelte es sich dabei um psychische Gewalt. Zwei Drittel der Betroffenen leiden unter den Folgen der erlebten Gewalt. – Das sind drei der zentralen Erkenntnisse aus einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN), die von der WEISSER RING Stiftung finanziell gefördert wurde. An diesem Donnerstag wurden die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Gewalt gegen Männer in Partnerschaften“ in Hannover vorgestellt.
Die Folgen von Gewalt
In den Räumen des KFN wies Projektleiter Dr. Jonas Schemmel darauf hin, dass die Forscher bei ihrer Studie bewusst mit einem „sehr weit gefassten Gewaltbegriff“ gearbeitet hätten, „so wie er in der deutschen Forschung auch angewandt wird“. Insgesamt legten sie den Studienteilnehmern rund 35 unterschiedliche Gewaltformen vor, darunter auch leichte Formen der verbalen Aggressionen. „Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen von Gewalt“, sagte Schemmel. Insgesamt 30 Prozent der Befragten gaben dabei an, körperliche Gewalt erfahren zu haben – dazu zählten zum Beispiel absichtliches Wegstoßen, Beißen, Kratzen, Kneifen und leichte oder harte Ohrfeigen.
Schemmel betonte, dass die Forschenden bei dem Projekt keinesfalls Gewalt gegen Frauen bagatellisieren wollen. Die Teilnehmer der Veranstaltung waren sich einig, dass Frauen weitaus häufiger und auch schwerer von Gewalt betroffen seien als Männer. Es bestehe aber kein Zweifel, dass auch Männer unter den Folgen der erlebten Gewalt litten. Neben zumeist oberflächlichen körperlichen Verletzungen wie blaue Flecken und Prellungen hätten die Studienteilnehmer den Wissenschaftlern von Stress und Anspannung berichtet, dem Gefühl von Erniedrigung und Ohnmacht sowie starken Angstgefühlen.
Warum Betroffene kaum Anzeige erstatten
Dennoch hätten sich nur wenige Betroffene Hilfe bei Polizei oder Beratungsstellen gesucht. Das liegt weniger an fehlendem Vertrauen in die Institutionen, sondern mangelnder Wahrnehmung als Betroffener. Studienteilnehmer Stefan beschreibt es so: „Ich habe mich ja nicht als Opfer gefühlt.
Eine überraschende Erkenntnis: Es sei teils „sehr schwer, auseinanderzuhalten, wer Opfer und Täter sei“. Es gäbe einen großen „Overlap“, sprich: eine große Überschneidung. Viele Männer gaben an, nicht nur Betroffener zu sein, sondern selbst Gewalt ausgeübt zu haben.
Auf Grundlage der Studienergebnisse haben die Forscher bei einer Fachtagung im Mai 2023 acht Handlungsempfehlungen entwickelt:
- Das Angebot an Beratungsstellen, die spezialisierte Angebote für gewaltbetroffene Männer vorhalten, sollte deutlich ausgebaut werden.
- Im Beratungskontext sollte die Komplexität von Partnerschaftsgewalt berücksichtigt werden: Viele Betroffene haben selbst schon einmal Gewalthandlungen begangen und viele dysfunktionale Beziehungen sind von einer wechselseitigen Gewaltdynamik gekennzeichnet.
- Männer benötigen eine proaktive Ansprache, um die Beratungsquote zu erhöhen. Aufgrund der stigmatisierenden Wirkung des Gewaltopfer-Begriffs und wegen der sehr unterschiedlichen Auffassungen von Gewalt könnte erprobt werden, ob ein Verzicht auf den Gewaltbegriff die Ansprache verbessert. Eine solche Ansprache könnte auch verwendet werden, um Männer bereits vor dem eigentlichen Gewaltausbruch für eine Beratung zu motivieren, was im Sinne einer Prävention sehr wünschenswert wäre.
- Auch für Männer braucht es mehr Orte, an denen sie bei Bedarf spontan Unterkunft finden, gegebenenfalls auch mit Kindern (Männerhäuser).
- Polizeibeamte sollten für unterschiedliche Täter-Opfer-Konstellationen bei häuslicher Gewalt noch stärker sensibilisiert werden.
- Partnerschaftsgewalt in all seinen Facetten sollte Gegenstand einer Sensibilisierungskampagne sein, die auch die Betroffenheit von Männern thematisiert, Betroffene auf Hilfe- und Beratungsmöglichkeiten hinweist und die Rolle und Aufgaben der einzelnen Akteur*innen (Beratungsstellen, Polizei, Gerichte) erklärt.
- Gerade in pädagogischen Einrichtungen braucht es schon früh einen kritischen Um-gang mit männlichen und weiblichen Stereotypen. Jungen sollten ebenso wie Mädchen ermutigt werden, sich von gesellschaftlichen Vorstellungen zu emanzipieren; Ge-fühle zu zeigen und zu verbalisieren darf nicht als unmännlich gelten.
- Beim Kampf gegen Partnerschaftsgewalt dürfen nicht beide Geschlechter gegeneinander ausgespielt werden. Das bedeutet, dass auch die Gewalt von Männern gegenüber Frauen weiterhin angemessen problematisiert und mit Maßnahmen angegangen wer-den muss.
Bei einer Podiumsdiskussion im Anschluss von Schemmels Ausführungen, nannte Björn Süfke von der Männerberatungsstelle man-o-mann aus Bielefeld die Handlungsempfehlungen „perfekt“. Er wies aber darauf hin: „Sieben der acht Punkte kosten Geld.“
Ähnliche Beiträge

Studie zeigt großes Dunkelfeld bei Gewalt
Eine neue Dunkelfeldstudie des Bundeskriminalamts im Auftrag der Bundesregierung zeigt, dass viele Gewalttaten nicht angezeigt werden. Besonders betroffen sind Frauen, junge Menschen und queere Personen.
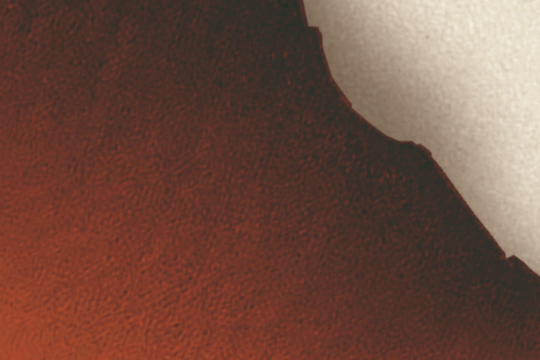
Viele bewaffnete Rechtsextremisten und „Reichsbürger“
Die Grünen haben in einer Anfrage an die Bundesregierung wissen wollen, wie viele Rechtsextremisten und "Reichsbürger" Waffen besitzen.

Bundesgeschäftsführerin Bianca Biwer wechselt zum Festspielhaus Baden-Baden
In der Bundesgeschäftsführung des WEISSEN RINGS, Deutschlands größter Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, kommt es zu Veränderungen.



Teile diesen Beitrag per: