Es gibt Dinge, die einfach nicht zueinander zu passen scheinen. Feuer und Wasser zum Beispiel oder – und darum soll es hier gehen: Boulevardjournalismus und Opferschutz. Opfer von Verbrechen, Unfällen oder großen Katastrophen und ihre Angehörigen sind verletzt und verletzlich. Journalisten, und unter ihnen besonders die Boulevardjournalisten, leben quasi von dem Leid anderer Menschen. Sie haben die zynische Journalisten-Regel im Blut: Only bad news are good news. Je schrecklicher ein Verbrechen, je größer das Unglück, je größer die Zahl der Opfer – desto größer die Schlagzeile, desto hemmungsloser die Reporter.
Fairerweise muss man hinzufügen: Das gilt zwar in besonderem Maße für Boulevard-Blätter wie die „Bild“-Zeitung oder den Kölner „Express“. Dies gilt aber in Wahrheit für alle Medien, seit es Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen gibt. Und leider erst recht, seit es die sogenannten „Sozialen Netzwerke“ gibt, auf denen jede und jeder nahezu ohne jede Einschränkung die Tür zu wirklich allen denkbaren menschlichen Abgründen aufreißen kann.
34 Jahre selbst als Journalist gearbeitet
Ich habe 34 Jahre lang als Journalist gearbeitet, beinahe die Hälfte der Zeit beim „Express“, bei „Bild“ und „Bild am Sonntag“. Und ich hatte das Pech (oder das Glück?), mich gleich zu Beginn meiner Laufbahn mit den Themen Tod, Opferschutz und der Frage „was geht und was geht nicht?“ auseinandersetzen zu müssen: Im Juli 1976 hatte ich meine ersten Zeilen als freier Mitarbeiter im Lokalteil der „Bonner Rundschau“ geschrieben, kein Boulevardblatt, sondern eine eher piefige kleine Zeitung. Im August war mein Vater gestorben, und kaum war ich wieder in der Redaktion, stießen am 10. September 1976 über Zagreb zwei Flugzeuge zusammen. Eines voller Urlauber auf dem Heimweg von Split nach Köln. 107 Todesopfer aus dem Verbreitungsgebiet der Zeitung.
Völlig empört wies ich den Auftrag meines Redaktionsleiters zurück, mich auf den Weg zu machen, um bei Angehörigen Fotos der Opfer aufzutreiben. Dies umso mehr, als ja gerade erst mein Vater gestorben war und ich zum ersten Mal erfahren hatte, wie man sich fühlt, wenn gerade ein Angehöriger gestorben ist. Aber alle (!) in der Redaktion, auch mein Betreuer, machten mir klar: Wenn ich mich jetzt nicht auf den Weg mache, habe ich den falschen Beruf gewählt.
Also zog ich mit weichen Knien und flauem Magen los, klingelte bei mir völlig fremden Menschen in einer absoluten Ausnahmesituation an der Tür, kondolierte und bat um Fotos ihrer toten Angehörigen und entschuldigte mich zugleich für diese Übergriffigkeit.
Niemand knallte die Tür zu
Ich hatte fest damit gerechnet, dass mir entweder gar nicht geöffnet werden würde – oder spätestens bei der Vorstellung die Tür wieder zugeknallt worden wäre. So, wie ich es wohl als Opfer gemacht hätte.
Es geschah genau das Gegenteil. Ausnahmslos alle öffneten nicht nur bereitwillig, sondern baten mich herein, kochten Kaffee und erzählten mir ihre Geschichte, suchten schöne Fotos ihrer Verstorbenen heraus. In einem Fall wurde mir sogar die letzte Ansichtskarte der verunglückten Urlauber geradezu aufgedrängt. Am Ende des Tages hatte ich zirka 15 Fotos „eingesammelt“ – und besagte Ansichtskarte.
Diese Geschichte hat mich noch lange und intensiv beschäftigt, weil ich meinen Job einerseits als unanständig empfunden, ihn mir andererseits aber schöngeredet hatte: Habe ich nicht letztlich ein gutes Werk vollbracht, weil ich aufgelösten traurigen Menschen einfach zugehört habe? Ein befreundeter Pfarrer lieferte mir sogar noch den biblischen Unterbau und erwähnte 1. Mose 16,13: „Du bist der Gott, der mich sieht“ – und sagte mir: Opfer sind zutiefst traurig, aber sie wollen auch gesehen werden.



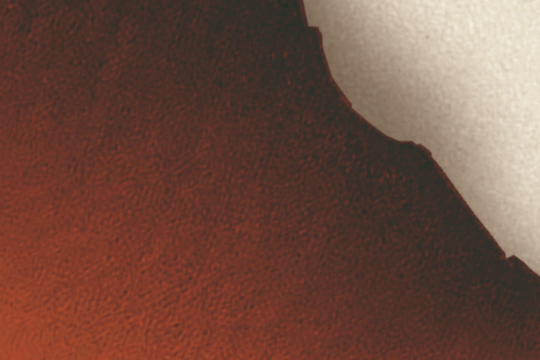


Teile diesen Beitrag per: