Christian Schertz: „Opferrechte bleiben bei True Crime auf der Strecke“
Mörder haben mehr Rechte als ihre toten Opfer. Die aktuelle Rechtslage ist kaum zu ertragen, meint der Medienanwalt Christian Schertz.

Foto: Jens Kalaene / dpa
True-Crime-Formate, sei es als Podcast oder im Fernsehen, gehen durch die Decke. In den letzten Jahren erfreuen sich serielle Formate in Film und Fernsehen oder auch Podcasts, die unter dem Label „True Crime“ rangieren, höchster Beliebtheit. Dabei gibt es die mediale Darstellung wahrer Verbrechen als populäre Gattung bereits seit längerer Zeit. Auffällig ist aber, dass gerade öffentlich-rechtliche Fernsehsender oder auch Qualitätszeitungen und Magazine wie „Stern“ und „Zeit“ in den letzten Jahren derartige Formate unter eigenen Marken wie „Zeit Verbrechen“, „Stern Crime“ oder Podcasts wie „Sprechen wir über Mord?! Der SWR 2 True Crime Podcast“ anbieten. In der ARD Mediathek sind unzählige True-Crime-Fälle unter dem Label „ARD Crime Time“ zum Streamen abrufbar. Nicht weiter erwähnt seien in diesem Zusammenhang auch noch die zahlreichen Formate, die von privaten Dienstleistern angeboten werden, auch für bezahlte Streamingdienste. Den Erfolg, aber auch den Markt für die mediale Vermarktung wahrer Verbrechen, kann man nur ahnen, wenn etwa auf der Webseite von RTL+ sogar die „RTL+ True-Crime-Offensive“ angekündigt wird.
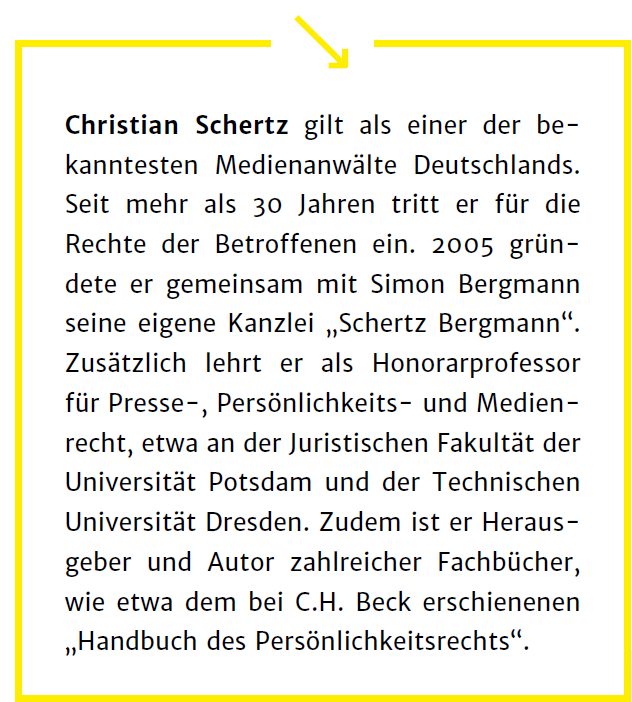
Wie verhält es sich aber mit dem Leid der Opfer und ihren Persönlichkeitsrechten? Dieses beziehungsweise diese werden im Ergebnis zur Unterhaltung des Publikums und zur Generierung von Klickzahlen und Einschaltquoten ausgeschlachtet, ohne dass sie aufgrund des geradezu zynischen Umstandes, dass sie verstorben sind (und damit ihr Schicksal für das Format überhaupt erst in Betracht kommt), gar nicht gefragt werden konnten. Die Antwort lautet klar und eindeutig: Die Opferrechte bleiben bei diesen Formaten auf der Strecke. Das liegt zum einen an der Gesetzeslage, aber auch an der Rechtsprechung in Deutschland, insbesondere was den postmortalen Persönlichkeitsschutz angeht:
Solange die Opfer am Leben sind, ja glücklicherweise am Leben geblieben sind, ist die Sache noch relativ eindeutig und einfach. Opfer, auch Opfer spektakulärer Verbrechen, sind grundsätzlich nicht als Personen der Zeitgeschichte anzusehen. Sie genießen daher den besonderen Schutz der Rechtsordnung. Ein besonderes Informationsinteresse der Öffentlichkeit an der Abbildung von Opfern ist daher überhaupt nur in ganz besonderen Ausnahmefällen anzuerkennen. Opfer von Sexualstraftaten etwa sind besonders schützenswert, so dass eine Veröffentlichung ihrer Fotos einer ausdrücklichen Einwilligung bedarf, wie etwa das Kammergericht entschied.
Überlebende genießen besonderen Schutz
Ebenso erkannte das Hanseatische Oberlandesgericht, dass das Opfer eines Mordversuches grundsätzlich Anspruch darauf hat, dass das an ihm begangene Verbrechen nach Abschluss des gerichtlichen Verfahrens und der Berichterstattung in der Presse nicht auch noch zum Gegenstand eines Fernsehfilms gemacht wird.
Anders ist die Rechtslage, wenn die Opfer verstorben sind. Dies dürfte die meisten True-Crime-Formate betreffen, da es regelmäßig um „spektakuläre Mordfälle“ geht.
Das Recht am eigenen Bild steht zunächst einmal nur Lebenden zu. Zu Lebzeiten bedarf nämlich die Verbreitung eines Bildnisses in den Medien der Zustimmung des oder der Abgebildeten, es sei denn, es handelt sich um Personen der Zeitgeschichte. Dies ist bei Opfern in der Regel nicht der Fall. Nach dem Tod der abgebildeten Person bedarf es lediglich während weiterer zehn Jahre für eine Bildnisveröffentlichung der Einwilligung der Angehörigen, also des Ehegatten, der Eltern oder der Kinder. Im Ergebnis heißt das, dass die Rechte der Opfer an ihrem Bildnis und damit auch an der bildlichen Darstellung ihres Schicksals nach der aktuellen Gesetzeslage nach zehn Jahren erlöschen.
Gesetzgeber muss reagieren
Hier ist gerade in Anbetracht der beschriebenen Entwicklung, ja insbesondere der wirtschaftlichen Ausschlachtung derartiger Fälle durch Medienkonzerne, der Gesetzgeber aufgerufen, diese Fristen zu verlängern. Eine summarische Sichtung der aktuell angebotenen True-Crime-Formate betrifft Fälle, die zumeist länger als zehn Jahre zurückliegen, so dass hier bildliche Darstellungen ohne weitere Zustimmung naher Angehöriger der Mordopfer möglich sind – ein im Ergebnis nicht hinnehmbarer Zustand.
Das gilt umso mehr, als die Persönlichkeitsrechte von Tätern, also auch zumeist der Mörder, von höchster Stelle, nämlich dem Bundesverfassungsgericht, geschützt werden. Bereits im Jahre 1973 entschied das Bundesverfassungsgericht im sogenannten Lebach-Fall, dass selbst in Fällen besonders schwerwiegender Taten, die in die Kriminalgeschichte der Bundesrepublik Deutschland eingegangen sind, die Täter nach geraumer Zeit die Eigenschaft als sogenannte relative Person der Zeitgeschichte verlieren und beanspruchen könnten, dass nicht mehr identifizierend in Wort und Bild über sie berichtet wird. Das sei dem Resozialisierungsinteresse des Täters geschuldet. Im Ergebnis bedeutet dies nichts anderes, als dass die aus der Haft entlassenen Mörder bei medialen Darstellungen ihrer Taten gefragt werden müssen und gegebenenfalls sogar für ihre Einwilligung ein Honorar verlangen können, während die Opferrechte erloschen sind.
Viele Opfer ungeschützt
Damit aber nicht genug: Nicht nur das Recht am eigenen Bild besteht lediglich für zehn Jahre nach dem Tod fort. Mit dem Tod endet auch das verfassungsrechtlich allein lebenden Personen gewährleistete sogenannte allgemeine Persönlichkeitsrecht. Dieses schützt die Lebenden, sofern sie nicht Personen der Zeitgeschichte sind, vor identifizierenden Darstellungen ihres Schicksals. Sie müssen also gefragt werden. Kommt der Mensch jedoch zu Tode, besteht nur noch ein aus der Menschenwürde abgeleiteter sogenannter postmortaler Achtungsanspruch, der nur grobe Verzerrungen des Lebensbildes oder auch eben Verletzungen der Menschenwürde bei der konkreten Darstellung in Film, Fernsehen etc. untersagt. Dies dürfte überhaupt nur dann geltend zu machen sein, wenn die Tat und das Leid des Opfers in allen Einzelheiten dargestellt werden, wie es etwa zuletzt in dem Amazon-Crime-Format „Gefesselt“ über den Hamburger Säurefassmörder sicherlich der Fall gewesen sein dürfte. In teilweise unerträglichen filmischen Darstellungen wurden hier die Qualen der Opfer inszeniert, was zu Recht auf Kritik gestoßen ist. Im Regelfall jedoch dürfte der postmortale Achtungsanspruch die Opfer nicht vor einer Darstellung ihres Falls in True-Crime-Formaten schützen.
Zynischer Täterschutz
Es ist indes überhaupt kein Grund ersichtlich, warum der Gesetzgeber und die Rechtsprechung die Persönlichkeitsrechte von Verstorbenen nicht besonders schützen, ja sogar erlöschen lassen. Gerade das absurde Missverhältnis zwischen dem Schutz von Tätern im Interesse der Resozialisierung davor, schon relativ kurze Zeit nach der Tat nicht mehr identifizierend dargestellt zu werden, und dem faktisch nicht bestehenden Schutz von Opfern, insbesondere wenn sie verstorben sind, sowohl was die bildliche Darstellung wie auch die Schilderung des Falles generell angeht, mutet nur noch zynisch an. Der Gesetzgeber ist daher dringend aufgerufen, die Persönlichkeitsrechte von Opfern sowohl mit Blick auf das Recht am eigenen Bild wie auch auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht zu stärken. Die aktuelle Rechtslage ist nicht akzeptabel, eigentlich kaum zu ertragen. Die Opfer haben faktisch keine Rechte, aber auch keine Lobby, und wehren können sie sich auch nicht mehr: Das ist schlicht nicht gerecht.
Ähnliche Beiträge

Die sieben wichtigsten Erkenntnisse aus unserer Recherche
Monatelang hat die Redaktion des WEISSEN RINGS zu True Crime recherchiert – und so erstmals ein detailliertes Lagebild erstellt.

Ein Anruf bei Christian Schertz
Medien schlachten mit True Crime persönliche Tragödien aus, sagt der Medienanwalt – und fordert Nachbesserungen beim gesetzlichen Opferschutz.

Wie gehen True-Crime-Formate mit Betroffenen um?
Formate wie „Stern Crime" oder der Podcast „Mord auf Ex“ berichten über Kriminalfälle. Wie gehen Sie mit Betroffenen um?

Teile diesen Beitrag per: