Christian Solmecke erklärt, was True-Crime-Formate dürfen – und was nicht
Was rechtens ist und was nicht, erläutert der bekannte Anwalt und Medienrechtsexperte Christian Solmecke.

Foto: Tim Hufnagl
Wann müssen Fotos verpixelt werden? Wann dürfen Namen oder Orte genannt werden und wann nicht? Wer True-Crime-Formate aufmerksam verfolgt, stellt fest: In diesen Fragen scheinen die Macherinnen und Macher keine einheitliche Antwort zu kennen. Das Gesetz hingegen spricht eine klare Sprache. Was rechtens ist und was nicht, erläutert der bekannte Anwalt und Medienrechtsexperte Christian Solmecke.
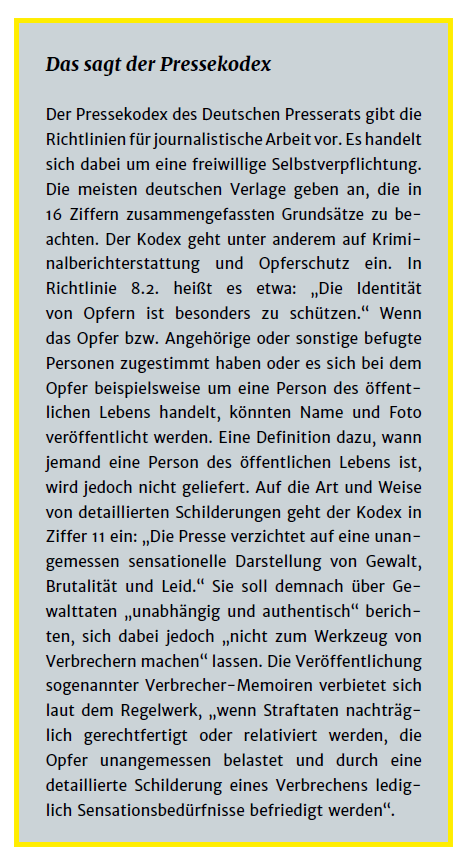
Christian Solmecke hat sich als Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei „Wilde Beuger Solmecke“ auf Beratungen in der Internet- und IT-Branche spezialisiert. Der 49-Jährige betreut auch Medienschaffende und schreibt Fachbücher zum Thema Online-Recht. Vor seiner Tätigkeit als Anwalt arbeitete er mehrere Jahre als Journalist, unter anderem für den Westdeutschen Rundfunk.
1) Verbrechensopfer haben klare Rechte
„Für alle Personen gilt, dass ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht nicht verletzt werden darf. Allein wenn das öffentliche Informationsinteresse überwiegt, darf unter Abwägung der Interessen berichtet werden. Für alle gilt weiterhin, dass unwahre Tatsachenbehauptungen nicht hingenommen werden müssen, zulässige Meinungsäußerungen jedoch schon“, sagt Solmecke.
„Für die Rechte von Opfern – tot oder lebendig – und Angehörigen ist vor allem maßgeblich, dass die Presse auch die Aufgabe hat, über zeitgeschichtliche Ereignisse und Straftaten zu berichten. Allgemein gilt jedoch der Gedanke des Opferschutzes.“
2) Identifizierende Berichterstattung ist nur in Ausnahmefällen gerechtfertigt
Identifizierende Berichterstattungen seien demnach nur ausnahmsweise gerechtfertigt, wenn die Identität des Opfers für das Verständnis eines Geschehens erheblich ist und das Verfahren mit großer Öffentlichkeitswirkung stattfindet.
Die Nennung des vollen Namens identifiziere die Person direkt und sei nach dieser Abwägung in aller Regel nicht zulässig. „Identifizierbar kann die Person aber auch dann sein, wenn der Nachname abgekürzt wird. Und zwar wenn noch andere Merkmale genannt werden (‚Erich H. aus Oldenburg‘). Das kann der Wohnort oder auch der geschilderte Tatort sein“, erläutert Solmecke.
3) Medien dürfen Fotos von Opfern nicht ohne Zustimmung veröffentlichen
Für die Bildberichterstattung gelte, dass grundsätzlich eine Zustimmung eingeholt werden muss. Nur wenn es ein Bildnis von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse sei, dürfe es im Einzelfall dennoch abgedruckt werden. Im Falle des Opfertodes müssen Angehörige in die Bildberichterstattung einwilligen, erklärt Solmecke weiter.
4) Für True Crime gelten meist strengere Regeln als für aktuelle Berichterstattung
„True-Crime-Formate berichten – anders als aktuelle Nachrichten – oft über lange zurückliegende Fälle. Das Informationsinteresse der Öffentlichkeit dürfte in diesen Fällen also abgeklungen sein, so dass die identifizierende Berichterstattung in wenigeren Fällen gerechtfertigt ist“, so Solmecke. Die identifizierende Berichterstattung über Opfer und Angehörige sei dann nur noch unter sehr hohen Anforderungen gerechtfertigt. Es müsse eine Einzelfallabwägung zwischen den Betroffenenrechten und den Öffentlichkeitsrechten stattfinden. „Nur wenn das Opfer beispielsweise prominent war oder andere Faktoren gegeben sind, weshalb das Informationsinteresse der Öffentlichkeit überwiegt, kann eine identifizierende Berichterstattung auch noch Jahre nach dem Fall gerechtfertigt sein.“
5) Sensationsjournalisten nehmen Rechtsverletzungen häufig billigend in Kauf
„Im Rahmen des Sensationsjournalismus wird die Verletzung von Persönlichkeitsrechten vor allem wegen der hohen Auflagenzahlen häufig gebilligt“, sagt Solmecke. „Je mehr Schock, Empörung und Befriedigung der Sensationsgier, desto höher leider oft der Gewinn.“ Die durch Prozesse anfallenden Kosten würden oft durch die mit der Berichterstattung erzielten Einnahmen übertroffen – zumal nicht alle Betroffenen die Kosten und Mühen eines Prozesses auf sich nehmen.
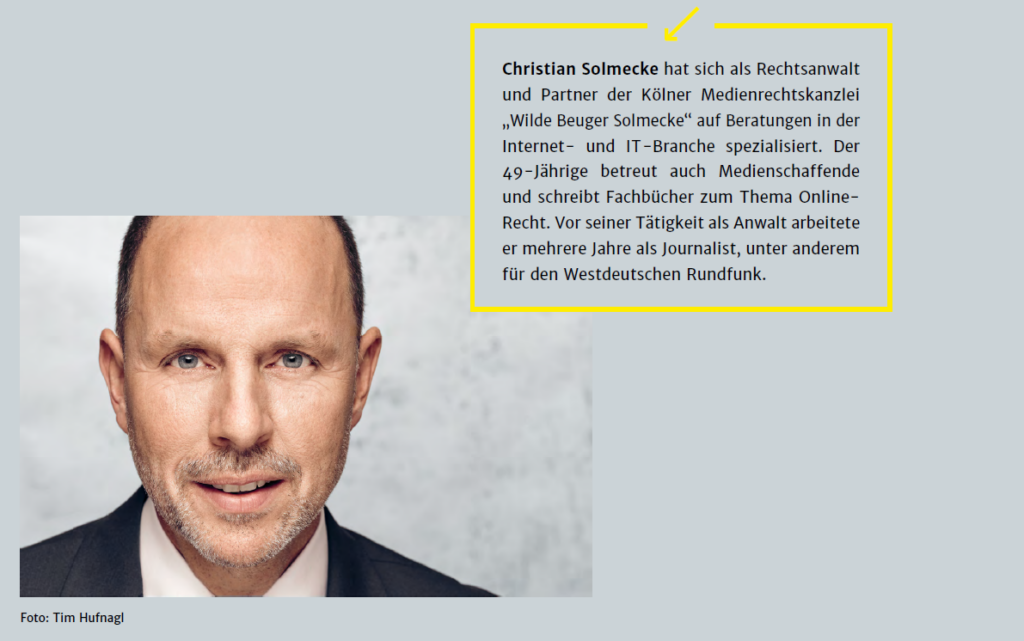
Ähnliche Beiträge

True Crime – sinnvoll oder voyeuristisch?
Als Autorin und Regisseurin hat Christiane Fernbacher über fünf Jahre lang True-Crime-Dokumentationen für das öffentlich-rechtliche Fernsehen umgesetzt. Hier erklärt sie, warum sie damit aufgehört hat.

Wie gehen True-Crime-Macher:innen mit Betroffenen um?
Das Magazin „Stern Crime“, der Podcast „Mord auf Ex“ oder YouTuberin Kati Winter – sie alle berichten über echte Kriminalfälle, und das sehr erfolgreich. Aber wie gehen Sie mit Betroffenen um?

„Ich bin nicht dafür da, dass andere an meinem Unglück Geld verdienen“
Der ungelöste Mord an ihrer Tochter Frauke beschäftigt Ingrid Liebs seit dem Jahr 2006. All die Jahre über war sie in verschiedenen Medien und True-Crime-Formaten präsent. Das hat sich geändert.

Teile diesen Beitrag per: