Ein Anruf bei … Klaus Püschel
Professor Dr. Klaus Püschel ist einer der bekanntesten deutschen Rechtsmediziner und weltweit als Gutachter im Einsatz. Der Hamburger Forensiker hat die Titelgeschichte „Die Scham muss die Seite wechseln!“ zum Fall Pelicot im aktuellen WEISSER RING Magazin gelesen und fordert: Wir müssen beim Thema Sexualstraftaten mehr über die Möglichkeiten der medizinischen Beweissicherung reden. Betroffene, Ärzte und Öffentlichkeit bräuchten Informationen.

Spurensuche: Rechtsmediziner Klaus Püschel bei der Untersuchung einer Gewebeprobe im Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Foto: Christian Charisius/dpa
Herr Professor Dr. Püschel, Sie haben auf unsere Titelgeschichte zum Vergewaltigungsfall Gisèle Pelicot reagiert und sinngemäß gesagt: Es sei ja wichtig, über das Thema Scham zu sprechen – wichtiger aber sei es, über die Möglichkeiten der Medizin zu sprechen, damit nach einer Sexualstraftat frühestmöglich Beweise gesammelt werden können. Fasse ich Ihre Kritik korrekt zusammen?
Ich will keine Wertung vornehmen, was wichtiger ist oder unwichtiger ist. Ich sage bloß: Wichtig ist auch die Medizin. Es gibt die Möglichkeit der Beweismittelsicherung. In Ihrer Titelgeschichte wird wiederholt darauf hingewiesen, dass die Beweislage im Fall Pelicot klar gewesen sei. Das war sie aber nur, weil der Ehemann die Taten mit Filmaufnahmen dokumentiert hat. In dem Text wird an keiner Stelle erwähnt, dass man eine Beweissicherung auch durch medizinische Diagnostik hätte bekommen können.
Hätte man das tatsächlich in diesem Fall, in dem es um eine Frau geht, die betäubt wurde und nach eigenen Angaben nichts von den Gewalttaten mitbekommen hat?
Ich kenne nicht die Details aus der Akte. Aber ich habe das Buch gelesen von Caroline Darian, der Tochter von Gisèle Pelicot. Darian schreibt ausdrücklich, dass ihre Mutter bei verschiedenen Ärzten gewesen sei. Die Rede ist von Neurologen, Gynäkologen und Allgemeinmedizinern und davon, dass sie dort ihre Beschwerden geschildert habe. Da wäre eine Beweismittelsicherung möglich gewesen, wenn die Ärzte daran gedacht hätten, dass die Beschwerden auch mit sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung zusammenhängen könnten. Es gab viele Täter, die haben Spuren als mögliche Beweismittel hinterlassen.

Die Mission von Gisèle Pelicot
„Die Scham muss die Seite wechseln“ sagt Vergewaltigungsopfer Gisèle Pelicot. Aber geht das überhaupt?
Sie nehmen die Ärzte in die Pflicht. Wenn wir aufs deutsche Gesundheitssystem schauen: Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Arzt in einem Fall wie dem der betäubten Gisèle Pelicot Verdacht schöpft und durch weitergehende Untersuchungen ein Verbrechen aufdeckt?
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Das liegt daran, dass wir es versäumen, in der Ärzte-Fortbildung darauf hinzuweisen. Und dass es dafür im kassenärztlichen System keine Finanzierung gibt. Als Rechtsmediziner weisen wir seit Jahrzehnten auf dieses Problem hin. Wir haben mit den kassenärztlichen Vereinigungen darüber gesprochen, und die haben sich nicht für zuständig erklärt. Ich wundere mich sehr darüber, weil die AOK selbst Merkblätter herausgibt zum Problem von K.-o.-Tropfen oder Vergewaltigungsdrogen. Aber sie schreibt nur, dass die Untersuchungen stattfinden sollen, und nichts zur Finanzierung. Wir haben hier in Hamburg deshalb einen anderen Weg eingeschlagen.
Welcher Weg ist das?
Wir haben über die zuständigen Behörden erreicht, dass eine auskömmliche Pauschale gezahlt wird für die Untersuchung und Beratung von Opfern von Gewalt. Das gilt bei möglicher Kindesmisshandlung, bei Vernachlässigung alter Menschen und eben bei Gewalt gegen Frauen. Es greift aber nur, wenn die Frauen in die Rechtsmedizin kommen.
Das Opfer muss selbst aktiv werden – damit sind wir wieder beim Thema Scham.
Ja, die Frauen müssen in das System kommen, aber das System ist in Deutschland immer besser geworden. Die Betroffenen können sich mit Ärzten besprechen. Ärzte haben einen Vertrauensvorschuss, es gilt die ärztliche Schweigepflicht. Es gibt überall in Deutschland das System der anonymen Spurensicherung, auch in Kliniken, also nicht nur in der Rechtsmedizin. Da können die Frauen beraten werden. Und da können dann auch chemisch-toxikologische Untersuchungen durchgeführt werden, um die Frage der chemischen Unterwerfung – den Ausdruck finde ich ganz passend – durch Vergewaltigungsdrogen oder K.-o.-Tropfen abzuklären.
Professor Dr. Klaus Püschel, Jahrgang 1952, leitete bis 2020 das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Er klärt die Ursachen von Todesfällen auf und dokumentiert für Gerichtsprozesse Verletzungen von Gewaltopfern. Püschel ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
Welche medizinischen Möglichkeiten der Beweiserhebung gibt es?
Wenn wir den Fall Pelicot nehmen, dann könnten wir nachweisen, dass die Frau unter einer Drogeneinwirkung gestanden hat, von der sie nichts weiß. Dafür muss man chemisch-toxikologische Laboruntersuchungen in Auftrag geben, die Ärzte müssen die Signale zuvor also auch wahrnehmen. Bei einer körperlichen Untersuchung muss eine Ganzkörperuntersuchung gemacht werden, die Frau muss dafür vollständig entkleidet sein. Da muss geguckt werden, ob sie Verletzungen hat. Das können unter Umständen auch kleine Verletzungsspuren sein: Abschürfungen oder Unterblutungen, die auf Gewalt von fremder Hand hinweisen, auf Festhalten oder Niederdrücken. Dann muss eine Spurensicherung betrieben werden. Da geht es vor allen Dingen darum, Abstriche anzufertigen. Das macht man mit kleinen Tupfern. Dann kann man sagen, da ist DNA nachweisbar von fremden Personen. Und diese Personen kann man dann auch identifizieren. Die Frau bleibt anonym und kann sich überlegen, ob und wann sie das Ganze öffentlich machen will.
Wie viel Zeit darf zwischen Tat und Untersuchung vergehen?
Die Untersuchung muss zeitnah stattfinden, wenn man die aktuelle chemische Beeinflussung nachweisen will. Wenn eine Frau in der Nacht oder am nächsten Morgen aufwacht und nicht weiß, was passiert ist, dann ist es falsch, nach Hause zu gehen, sich ins Bett zu legen oder zu duschen.
Wir haben es mit Betroffenen zu tun, die womöglich schockiert sind, ängstlich, aufgelöst, verzweifelt …
… ja, ich weiß, das ist sehr theoretisch, was ich sage. Aber es ist extrem wichtig, kurzfristig zu einer Stelle zu gehen, die sich gedanklich mit dem Thema schon mal befasst hat und dafür sorgt, dass Blut, Urin und Haare für chemisch-toxikologische Untersuchungen sowie Abstriche für spurenkundliche DNA-Untersuchungen gesichert werden. Auch sollten Kleidungsstücke wie zum Beispiel der Slip gesichert und untersucht werden. Alle Verletzungsbefunde sind schriftlich und fotografisch mit Maßstab zu dokumentieren. Das ist alles kein Hexenwerk. Deshalb muss da mehr Aufklärung geleistet werden.
Wen sehen Sie als Aufklärer in der Pflicht?
Zum Beispiel uns beim WEISSEN RING. In Ihrer Titelgeschichte kommen viele Experten aus verschiedenen Fachbereichen zu Wort, aber ich habe nirgendwo etwas zu den medizinischen Aspekten gelesen.
Transparenzhinweis:
Klaus Püschel ist seit mehr als 45 Jahren Mitglied im WEISSEN RING e.V.
Ähnliche Beiträge

Wie viel ist ein Mensch wert?
Menschenhandel geschieht mitten unter uns: Zwangsprostitution, Zwangsverheiratung und Arbeitsausbeutung.

Pornografisches im Posteingang
Studierende erleben an deutschen Hochschulen digitale Gewalt – per E-Mail, in sozialen Netzwerken und auf Lernplattformen im Internet. Drei junge Frauen wollen das ändern.
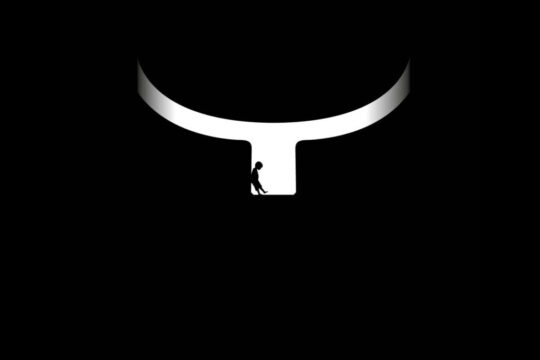
Hilf(e)los und gottverlassen
Hedwig T. berichtet von sexuellem Missbrauch durch einen Pfarrer in ihrer Kindheit. Die Taten sind verjährt.


Teile diesen Beitrag per: