„Klare Grenzen“ beim Einsatz der Fußfessel
Bei häuslicher Gewalt kann in Hamburg die Fußfessel eingesetzt werden. Genutzt wurde diese Möglichkeit seither nur einmal. Warum? Ein Gespräch im Hamburger Landeskriminalamt.

Foto: Mohssen Assanimoghaddam
In Hamburg können Personen, von denen Gefahr für Leib und Leben droht, seit Ende 2019 verpflichtet werden, eine sogenannte Fußfessel zu tragen – auch bei häuslicher Gewalt. Genutzt wurde diese Möglichkeit seither nur einmal. Warum? Ein Gespräch im Hamburger Landeskriminalamt mit LKA-Chef Jan Hieber und Kriminalhauptkommissar Henning Ebeling.
„Hamburg: Paare immer brutaler“ – so titelte im Mai eine Hamburger Tageszeitung. Man gewinnt den Eindruck, dass dieses Problem nicht in den Griff zu kriegen ist. Woran liegt das?
Hieber: Partnerschaftsgewalt ist – ein spezieller Fachausdruck aus der Kriminologie – ein ‚ubiquitäres Problem‘. Es ist wirklich überall verbreitet und auf keine soziale Schicht, Altersgruppe oder Ähnliches beschränkt. Wir haben aber keine Anstiege, die extrem besorgniserregend wären, also dass von einem Jahr aufs andere massive Steigerungen zu verzeichnen wären. In der Corona-Zeit haben wir einen Anstieg der Fälle von Partnerschaftsgewalt festgestellt. Das lag an den engeren räumlichen Bedingungen und daran, dass die Menschen sich weniger aus dem Weg gehen konnten. Aber es war auch nicht so, wie es in der Presse zum Teil dargestellt wurde: Es gab auch zu diesem Zeitpunkt keine explodierenden Zahlen. Klar ist jedoch, jede Tat ist eine zu viel, und daher bleibt Partnerschaftsgewalt ein Thema, das wir unbedingt ernst nehmen müssen. Und das tun wir in Hamburg auch.

Das heißt?
Hieber: Wir haben viele speziell ausgebildete Kollegen, die sich sehr gut in diesem komplexen Thema auskennen. Und es gibt in Hamburg eine Sonderstaatsanwaltschaft, die sich fachlich sehr tief mit diesem schwierigen Thema befasst, außerdem existiert eine Fülle von Hilfsangeboten für unterschiedliche Fallkonstellationen. Und wir haben, und das ist mir ganz, ganz wichtig, eine Risikobewertung, die extrem ausdifferenziert ist. Ich sage damit nicht, dass dieses System perfekt ist. Es wird uns leider nie gelingen, eskalierende Gewalt komplett zu verhindern. Aber das ist das, was uns am allerstärksten antreibt: so viele eskalierende Fälle, wo auch Tötungsdelikte am Ende stehen können, wie möglich frühzeitig zu erkennen. Um den Gewaltkreislauf gerade in diesen Fällen rechtzeitig zu unterbrechen.
Ebeling: Der Gewaltkreislauf führt oft dazu, dass Opfer sich nicht von Tätern trennen wollen – oder nach einer Trennung wieder den Kontakt aufnehmen. Da ist oft psychischer Druck vom Täter im Spiel oder Abhängigkeiten wie Kinder, Geld oder ein Haus. Ich habe mal eine Frau betreut, die hat mit ihren zwei Kindern eineinhalb Jahre in einem Frauenhaus in Schleswig-Holstein gewohnt, wohin sie vor ihrem Partner geflüchtet war. Nach eineinhalb Jahren hatte sie ihre erste Wohnung in Hamburg. Und wen ruft sie an für die Elektroarbeiten im Haus? Den Mann. Das ist natürlich schrecklich. Ich habe sie vernommen, und dabei ist es aus dem neunjährigen Sohn rausgeplatzt, dass er vom Papa heftig geschlagen wurde. Und dann zieht er sein T-Shirt aus: überall Striemen auf dem Rücken von den Elektrokabeln. Und wer beginnt zu weinen? Die Mutter. Und sie sagt: „Du, wenn du das jetzt sagst, wird Papa ganz doll bestraft.“ Wenn die Opfer immer wieder zu den Tätern zurückkehren, können wir als Polizei das nicht verhindern. Aber wir können in so einem Fall Maßnahmen ergreifen, um die Kinder zu schützen, und vor allem immer wieder Angebote machen, sich aus dem Gewaltkreislauf zu lösen und die Trennung durchzuhalten.
Hieber: Dieser Fall ist sehr tragisch, aber er steht leider auch exemplarisch für viele andere Fälle. Das zeigt, dass es um Empowering gehen muss. Die Polizei kann den Täter wegweisen, dafür gibt es die klare Regelung: Wer schlägt, der geht. Aber es ist dann eben auch erforderlich, dass das Opfer nicht die Tür aufmacht, wenn der Täter wieder davorsteht, sondern dass es die Polizei ruft. Dann können wir agieren.
In Hamburg gibt es die Möglichkeit, in Fällen von häuslicher Gewalt die Täter per elektronischer Fußfessel zu überwachen.
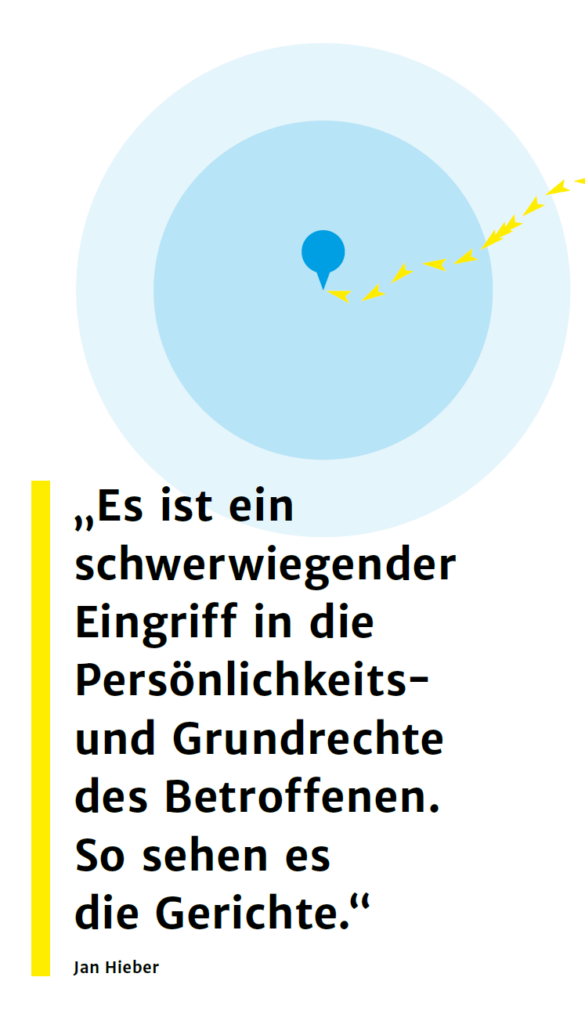
Hieber: Diese Maßnahme macht auf den ersten Blick große Hoffnung, weil man denkt: Na, Mensch, wenn man da so einen Täter hat, der gefährlich werden kann, dann legen wir dem eine Fußfessel an. Und dann haben wir ihn unter Kontrolle. Aber das ist ein Irrglaube. Es ist ein schwerwiegender Eingriff in die Persönlichkeits- und Grundrechte des Betroffenen. So sehen es die Gerichte. Das kann man nicht einfach so machen, weil beispielsweise jemand angezeigt wurde, da muss schon etwas an gerichtsverwertbaren Fakten auf dem Tisch liegen. Die Gerichte verlangen, dass eine unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben besteht, um diese Maßnahme anzuordnen. Eine unmittelbare Gefahr, keine abstrakte. Wenn diese besonderen Voraussetzungen aber gegeben sind, können wir die Person stattdessen auch in Präventivgewahrsam nehmen. Das ist wahrscheinlich in vielen Fällen die eher geeignetere Maßnahme.
Sie sehen also in der elektronischen Fußfessel keine geeignete Maßnahme?
Hieber: Die Fußfessel ist nicht per se als ungeeignet anzusehen, sie ist eine von mehreren Optionen. Aber es sind daran eben extrem hohe Voraussetzungen geknüpft. Wenn die erfüllt sind und ich aus polizeilicher Sicht eine so große Gefahr annehme, dann ist die Frage: Kann ich jemanden überhaupt mit einer Fußfessel noch losgehen lassen? Weil: Was macht denn die Fußfessel? Die Fußfessel überwacht über ein Zentrum in Hessen die Bewegung des Trägers. Das ist ja nicht so, dass das verhindert, dass jemand irgendwo hingeht. Beispielsweise wohnt der Mann mit der Fußfessel in Hamburg-Wandsbek und die Frau in Hamburg-Mitte. Jetzt geht der Mann in die Innenstadt. Nun müsste ich eigentlich Polizeikräfte heranführen, um einen möglichen Kontakt zu unterbinden. Sie merken schon: Da gibt es große praktische Probleme. Die Fußfessel wäre eher geeignet, wenn ich einen Tatverdächtigen hätte, der in einer anderen Stadt lebt. Also der lebt in München und das Opfer in Hamburg. Unter den Umständen könnte ich viel eher sagen: Guckt mal, der bewegt sich hier mit ICE-Geschwindigkeit in den Norden. Ich glaube, jetzt sind wir gefordert. Aber solche Fälle sind äußerst selten.
Noch einmal: Sie befürworten die Fußfessel nicht in Fällen häuslicher Gewalt?
Hieber: Die elektronische Fußfessel ist eine häufig gestellte Forderung von Leuten, die das sicherlich in guter Absicht sagen, aber denen es vermutlich am praktischen Erfahrungswissen in diesem Bereich fehlt. Ja, es gibt dieses Rechtsinstrument, es hat aber extrem hohe Hürden. Und selbst wenn diese Voraussetzungen vorliegen, ist es immer die Frage, ist das hier die geeignete Maßnahme, oder gibt es andere Maßnahmen, die im konkreten Fall viel sinnvoller sind? Und ich verrate an dieser Stelle jetzt ein Geheimnis: In Hamburg treffen wir dann in der Regel andere Maßnahmen.
Ebeling: Ich sehe das Vorgehen als Sachbearbeiter der Polizei immer wie eine Treppe mit ganz vielen Stufen. Der erste Schritt ist natürlich, dass das Opfer zur Polizei geht. Das ist ja schon eine große Überwindung. Der nächste Schritt könnte zum Beispiel eine Gefährderansprache von unserer Seite sein. Und dann gibt es ja weitere Maßnahmen, zum Beispiel ein Aufenthaltsverbot. Eine der letzten Stufen ist die Fußfessel, aber die ist – wie Herr Hieber ausgeführt hat – an hohe Voraussetzungen gebunden und nur in wenigen Fällen wirklich sinnvoll. Andere Maßnahmen sind oft sinnvoller. Manchmal nutzen Gefährderansprachen. Die sind oft viel effektiver als eine Fußfessel, weil ich da hingehe und nerve. Manchmal nützt ein Kontakt- und Annäherungsverbot, manchmal ein Aufenthaltsverbot. Um es abschließend zu sagen: Eine Fußfessel kann nützen. Aber nur in exponierten Fällen, diese Maßnahme ist eben sehr speziell und sehr selten. Ich bin immer ganz gut mit den anderen Maßnahmen gefahren.
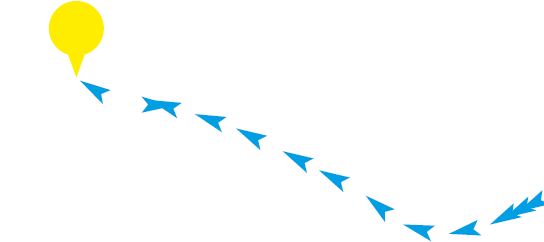
Sie beide beschreiben die elektronische Fußfessel, so wie sie hier in Deutschland, in Hamburg geregelt ist, als ungeeignet. Aber in Spanien wurde die Fußfessel seit 2009 tausendfach verhängt. Dort trägt auch das Opfer ein Gerät bei sich. Der Alarm wird in der Überwachungszentrale ausgelöst, wenn beide Geräte sich auf eine festgelegte Entfernung annähern, das Opfer wird gewarnt.
Hieber: Noch einmal ganz deutlich: Die Fußfessel ist nicht gänzlich ungeeignet, sie stellt eine von mehreren Optionen dar, und wir müssen in jedem Fall einzeln entscheiden, welche die beste ist. Spanien hat ein ganz anderes System, das ist mit unserem überhaupt nicht vergleichbar.
,,Wenn die Spanier so gute Erfahrungen mit ihrem System haben, dann müssen wir uns das anschauen und auswerten."
Jan Hieber
Laut dem spanischen Justizministerium wurde noch keine Frau unter dieser Überwachung von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. In Deutschland kommt es dagegen immer wieder vor, dass Frauen getötet werden, obwohl die Polizei ein Annäherungsverbot ausgesprochen hatte.
Hieber: Wenn die Spanier so gute Erfahrungen mit ihrem System haben, dann müssen wir uns das anschauen und auswerten. Unser Gesetzgeber hat uns jedoch klare Grenzen gesetzt. Wenn wir so ein System wie in Spanien wollen, dann ist die Politik, dann ist der Gesetzgeber gefragt. Der muss die Voraussetzungen dafür schaffen.
Was konkret raten Sie Opfern?
Hieber: Wenn Gefahr droht, rufen Sie die Polizei! Wir können dann beispielsweise die Wegweisung aussprechen, also den Täter oder die Täterin wegschicken. Das ist ganz wichtig, weil so das Opfer erst einmal die Möglichkeit bekommt, sich zu sammeln und über das weitere Vorgehen nachzudenken. Das betrifft auch zivilrechtliche Möglichkeiten. Denn das ist eine Entscheidung, die dann das Opfer trifft. Wichtig ist auch: alles dokumentieren. Dazu kann man spezielle Apps nutzen oder auch Stift, Papier und Handykamera. Eine Dokumentation macht auch die Polizei, aber das Opfer muss sich eben auch dafür entscheiden, die Polizei einzuschalten. Wichtig ist auch, im weiteren Verfahrensverlauf der Polizei jeden neuen Übergriff, jeden neuen Kontaktversuch von der Täterperson mitzuteilen. Der Beziehungsgewaltsachbearbeiter ist gehalten, wirklich ein offenes Ohr zu haben.
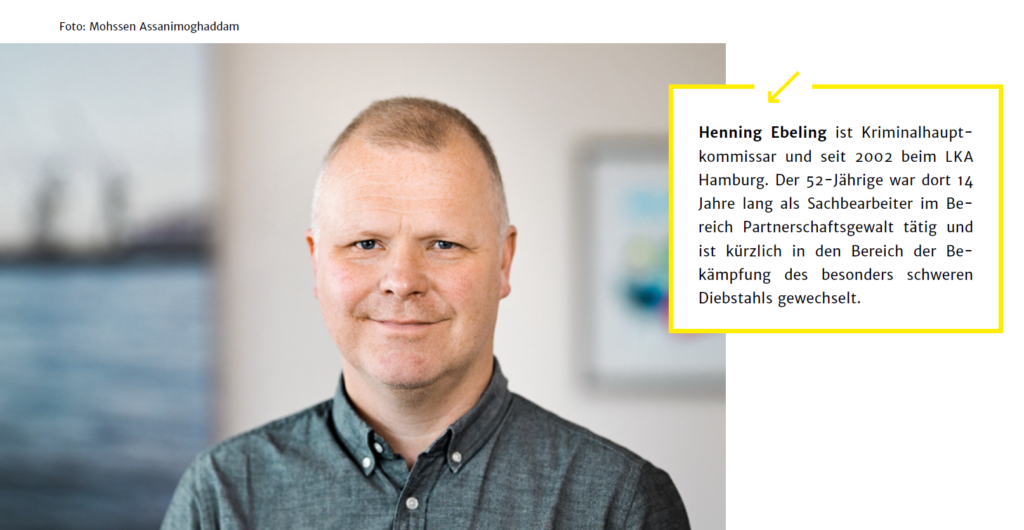
Was sollen Außenstehende machen, die Zeugen von häuslicher Gewalt werden?
Hieber: Wenn Sie beispielsweise mitbekommen, dass in der Nachbarwohnung Randale ist, wenn Sie befürchten müssen, es kommt zu Gewalttätigkeiten, rufen Sie bitte die 110 an. Die Meldung muss ja nicht vom Opfer kommen. Das Opfer schafft es oft nicht, diesen Schritt zu tun. Aber wenn jemand anderes die Polizei gerufen hat und unsere Kollegen stehen vor der Tür, dann findet es doch oft den Mut, den Täter anzuzeigen. Deshalb: Überwinden Sie Ihre innere Hemmung, in eine andere Intimbeziehung einzugreifen! Wenn Sie sehen, dass da jemand Opfer wird, dann gucken Sie nicht weg und sagen sich, das sei Privatsache. Gewalt ist keine Privatsache, Gewalt geht uns alle an.
Ähnliche Beiträge

“Eine kleine Narbe bleibt immer“
Moritz Müller spielt in der DEL. Der Profi der Kölner Haie sah sich Anfang 2024 mit einer Hassnachricht konfrontiert. Ein Gespräch über die Folgen.

„Zu sehen, wie unsere Tochter läuft, spielt und lacht, hilft uns“
Fünf Monate nach dem Messerangriff von Aschaffenburg spricht der Vater des verletzten Kleinkindes über die Tat.

Opfer dürfen nicht nur „Beweismittel“ sein
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht spricht im Interview mit dem WEISSEN RING über die Strafverschärfungen bei Missbrauchstaten und über den Kampf gegen Hass im Netz.

Teile diesen Beitrag per: