Ungefragt ausgenutzt
True Crime boomt. Journalisten erzählen „wahre Verbrechen“ nach, in Podcasts von Lokalzeitungen oder in großen Live-Shows. Fast immer geht es um Mord. Das Publikum ist begeistert, für die Hinterbliebenen aber ist es oft der blanke Horror, der sie buchstäblich zum zweiten Mal verletzt.

Die Show „Tödliche Liebe“ mit den Moderatoren Jacqueline Belle und Alexander Stevens verspricht dem Publikum „ein einzigartiges und fesselndes Erlebnis“ mit Tatortfotos und Akteneinsicht.
Die Angehörigen
(Ostfriesland)
Sie will am Samstag nur schnell zum Friseur, da sieht sie das Plakat im Schaufenster des örtlichen Zeitungshauses: Werbung für den True-Crime-Podcast „Aktenzeichen Ostfriesland“. Auf dem Plakat stehen ein QR-Code und drei kurze Sätze zum Mord an ihrer Schwester, „so eklig, dass ich sie nicht wiederholen will“, sagt Sophia* (27) später.
Im Internet findet sie einen Zeitungsartikel zum Podcast. Das Foto zum Artikel zeigt den Sarg ihrer Schwester. Sophia sieht ihn zum ersten Mal: 2008, als der Mord geschah, durfte sie nicht mit zur Beerdigung, sie war erst zehn Jahre alt. Sie bekommt eine Panikattacke, ihr Herz rast, sie schwitzt. Sie steigt ins Auto und fährt zur nächsten Polizeistation, „machen Sie doch etwas!“, schreit sie den Polizisten an, sie weint. Am Montag kann Sophia nicht zur Arbeit gehen, ihre Psychotherapeutin muss sie auffangen.
Sarah* (39), ihre Schwester, hat den Podcast bereits ein paar Tage vor Sophia entdeckt. Freunde haben ihr die Facebook-Werbung weitergeleitet, „mach das nicht an“, warnten sie. Natürlich macht sie es trotzdem an, es ist doch ihr Fall: der brutale Mord an ihrer Schwester, der Kummer der Familie, die Mutter, die an dem Tag ein Stück mitgestorben sei. Sie hört nur kurz zu, sofort sieht sie sich 16 Jahre zurückversetzt.
„Es fühlte sich an wie an dem Tag, als das alles passiert ist“, sagt sie später: die Angst, die Panik, der Schmerz. Und der Druck: Sie muss ihre Familie schützen. Die Schwester, die Mutter, der Vater – sie dürfen nicht von dem Podcast erfahren! Sarah erleidet einen Nervenzusammenbruch.
Leer ist eine kleine Stadt, Sarah kann ihre Familie nicht schützen. Sophia fährt zum Friseur, Nachbarn erzählen den Eltern von dem Podcast.
Die Angehörige
(Oberbayern)
Ein neuer Start an einer neuen Schule, eine neue Chance, niemand hier kennt ihre Geschichte. Barbara (38) hat ihren Mädchennamen abgelegt, sie hat eine Auskunftssperre für ihre Adresse beantragt. Auch sonst geht es ihr gut: Zum ersten Mal seit dem Mord an ihrer Zwillingsschwester hat sie der bevorstehende Jahrestag nicht aus der Bahn geworfen. Ausgerechnet jetzt erfährt Barbara von dieser True-Crime-Show: eine große Tournee, Zehntausende Zuschauer, im Mittelpunkt der Fall ihrer Schwester. Seit Tagen kann sie nachts nicht schlafen, jetzt sitzt sie mit Herzrasen und Flashbacks im Lehrerzimmer in der Konferenz.
In ihrer früheren Schule hatte die Polizei ihr die Todesnachricht überbracht. In der neuen Schule versucht sie, ihr Zittern zu verbergen. Nicht in Tränen auszubrechen. Nicht rauslaufen zu müssen. Es geht nicht. Barbara muss ihren neuen Kollegen erklären, wer sie ist und was damals geschah. „Ich hatte gedacht, ich könnte hier endlich neu anfangen“, sagt sie.
Am Nachmittag geht sie zur Gitarrenstunde, um sich abzulenken. Sie kann die Gitarre nicht festhalten, so sehr zittert sie.
Die Live-Show
(Hannover)
„Viel Spaß!“ wünscht der Mann an der Kartenkontrolle, „viel Spaß!“ wünscht die Frau am Getränketresen. Rund tausend Menschen drängen sich gut gelaunt ins „Theater am Aegi“ in Hannover, sie prosten sich zu mit Sekt und Bier.
„Tödliche Liebe“ heißt die Live-Show zum True-Crime-Podcast des Radiosenders Bayern 3, die Veranstalter versprechen ein „einzigartiges und fesselndes Erlebnis“, „mit Tatortfotos, Akteneinsicht und der Möglichkeit, live Fragen zu stellen“. Eintrittskarten kosten zwischen 39,90 und 49,90 Euro, VIP-Pakete gibt es ab 99,90 Euro. Gut 100 Termine sind geplant in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Kommentare im Internet sind positiv: „Super lustiger Abend für Fans und solche, die es noch werden wollen!“, lobt ein Fan aus Wien.
Auf der Bühne stehen zwei breite Sessel und ein Spaten, aus den Lautsprechern sickert dräuende Musik, und schon brandet Jubel auf: Jacqueline Belle (35) und Dr. Alexander Stevens (43) treten ins Scheinwerferlicht, Gastgeber des Bayern-3-Podcasts und Stars des Abends. Die nächsten eineinhalb Stunden wird es um einen Mord in Bayern gehen, um den Mord an Barbaras Zwillingsschwester. Belle und Stevens haben die Namen von Opfer und Täter geändert, „zum Schutz der Angehörigen“, sagt Belle, der Rest der Handlung folgt eng dem Original. True Crime bedeutet ja „wahre Verbrechen“.
KI-Bilder zeigen ein junges Paar, Laura und Stefan heißen die beiden hier, sie wollen bald heiraten. Dann verschwindet Laura spurlos. Der KI-Film stoppt, Cliffhanger.
„Habt ihr eine Idee, was mit Laura passiert ist?“, fragt Jacqueline Belle.
„Tot!“, ruft ein Witzbold in den Saal. Großes Gelächter.
Die wahre Laura verschwand 2012, 2013 wurde ihr Leichnam gefunden. Der wahre Stefan geriet in Verdacht, Ermittlungen wurden aufgenommen, eingestellt, wieder aufgenommen, wieder eingestellt. Die Familie der wahren Laura kämpfte dafür, dass der Fall weiterverfolgt wird. 2020 wurde dem wahren Stefan der Prozess gemacht. Das Gericht verurteilte ihn wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe und stellte die besondere Schwere der Schuld fest.
In der True-Crime-Show bleibt der Fall offen. Jacqueline Belle spielt die Rolle der Anklägerin, Alexander Stevens die des Strafverteidigers. Immer wieder bringt er Entlastendes für Stefan vor. Zum Beispiel zum Spaten, der am Fundort lag und für den sich ein Kaufbeleg bei Stefan fand: „Ich verrate dir einen uralten Strafverteidiger-Trick: nichts glauben, was dir die Polizei erzählt!“ Gelächter.
Das Show-Publikum darf mitraten und mit dem Smartphone Richter spielen.
„Hat Stefan mit dem Verschwinden von Laura zu tun?“„Ja“, sagen 58 Prozent, „Nein“ 42 Prozent.
Es wird Zeit für den Höhepunkt der Show. Belle und Stevens haben mit dem wahren Stefan im Gefängnis ein Interview geführt. Kein Laut ist zu hören im Saal, als der Mörder seine vom Gericht widerlegte Lüge wiederholt, es sei doch nur ein Unfall gewesen.
„Wie würdet ihr entscheiden, wenn ihr in diesem Gerichtssaal wäret?“
Knapp ein Viertel der Zuschauer hält Stefan, in Wahrheit ein rechtskräftig verurteilter Mörder, für unschuldig.
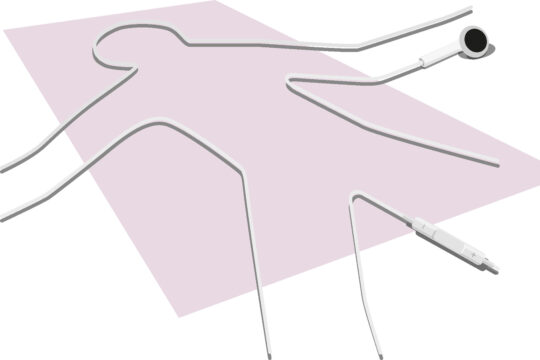
Die dunkle Seite des True-Crime-Booms
Wenn es immer mehr True-Crime-Formate gibt, die über wahre Verbrechen berichten, dann gibt es auch immer mehr Verbrechensopfer, deren Geschichte öffentlich erzählt wird – und die dadurch vielleicht ein zweites Mal verletzt werden. Ein Lagebericht zu True Crime in Deutschland.
Die Angehörige
(Oberbayern)
„Ins Loch gefallen“ sei sie, als sie vom Inhalt der Show erfahren habe, sagt Barbara, die Zwillingsschwester der wahren Laura. Das Video mit dem Mörder, die Verteidigerrolle von Stevens, die Abstimmung im Saal, „das stellt alles infrage, was meine Familie erreicht hat“.
Wenige Wochen vor dem Start der Show habe Jacqueline Belle mit ihr telefoniert und um eine Stellungnahme für die Show gebeten, sagt Barbara. Sie habe Belle gebeten, auf die Darstellung ihres Falls zu verzichten. „Das letzte Gespräch mit ihr habe ich heulend beendet.“ Sie besucht die Show nicht selbst, sie will sich schützen, aber sie lässt sich den Inhalt von Bekannten schildern. „Jetzt weiß ich, dass sie auf unseren Fall gar nicht verzichten konnten: Dann hätten sie ja keine Show mehr gehabt.“

„True Crime funktioniert“, sagt der Chefredakteur: „Aktenzeichen Ostfriesland“ ist der erfolgreichste Podcast der Zeitungsgruppe Ostfriesland – „mit riesigem Abstand“. Mit True Crime erreicht der Verlag junge Leser und bindet sie an die Zeitung.
Barbara schaltet eine Anwältin ein, die ein langes Schreiben an den Bayerischen Rundfunk (BR) aufsetzt. Unter anderem fordert sie, dass keine Bilder aus der Originalakte in der Show gezeigt werden. Es geht unter anderem um ein Bild von der Unterwäsche ihrer Schwester.
Lang ist auch die Antwort aus der Rechtsabteilung des BR, eher knapp der Inhalt: Der BR könne als Lizenzgeber der Show nicht in das Bühnenprogramm eingreifen, sehe aber auch keinen Anlass dafür. Opferrechte würden nicht verletzt, das Leid der Angehörigen nicht relativiert.
Aber: Die Moderatoren der Show hätten zugesagt, künftig keine Originalbilder aus der Akte mehr zu verwenden.
Der Podcast
(Ostfriesland)
Stimme 1: „Hier passieren durchaus auch Morde, Totschläge, allerlei Gewaltdelikte … das sticht natürlich trotzdem komplett heraus.“
Stimme 2: „Ich war ehrlich gesagt ziemlich geflasht … dass ich gedacht habe: krass … das hier in Leer?!“
Stimme 1: „So viel können wir, glaube ich, schon mal sagen, es sind wirklich Abgründe, die sich da auftun, und auch verstörende Details.“
Stimme 2: „Bleibt dran, es bleibt spannend!“
Die beiden Lokaljournalisten der Zeitungsgruppe Ostfriesland sind fasziniert. Der 16 Jahre zurückliegende Mordfall, den sie im Zeitungsarchiv entdeckt haben, der Mord an Sophias und Sarahs Schwester, ist besonders: besonders verstörend, besonders grausam, besonders spektakulär. Fünf Folgen nehmen sie sich Zeit, die Geschehnisse im Podcast „Aktenzeichen Ostfriesland“ nachzuerzählen.
Im Lokaljournalismus funktionieren True-Crime-Podcasts zumeist so: Zwei Zeitungsjournalisten sprechen über das, was sie im Zeitungsarchiv recherchiert haben. So ist es auch hier, die Journalisten spekulieren über eine mögliche Beziehung von Opfer und Täter, über das mögliche Motiv des Täters, über seinen möglichen Suizid. Antworten können sie nicht geben, der Täter starb am Tag der Tat bei einem Autounfall, juristisch aufgearbeitet wurde der Mord deshalb nie.
„Bleibt dran, es bleibt spannend!“
Die Folgen heißen „Der Crash“ oder „Die Beerdigung“, jeder Folge steht eine Triggerwarnung voran: „Die Inhalte, die wir schildern, können belastend und retraumatisierend sein. Wenn du befürchtest, dass dir das nicht guttun könnte, hör bitte nicht weiter.“ Vor Facebook-Werbung, vor Schaufenster-Plakaten, vor gesprächigen Nachbarn wird nicht gewarnt.
In der letzten Folge sprechen die Journalisten über „Die Berichterstattung“.
Stimme 1: „Klar, natürlich konnte man nicht mehr mit (dem Mordopfer) in Rücksprache treten, das liegt in der Natur der Sache dieses schrecklichen Ereignisses. Aber es geht ja auch viel um die Angehörigen, die Hinterbliebenen und so.“
Stimme 2: „Die Angehörigen müssen beklagen, dass ihr Kind gestorben ist, und auch noch auf eine brutale Art und Weise getötet worden ist … und dann müssen sie diese Öffentlichkeit noch ertragen. Ich weiß von vielen dieser Familien, dass die das nicht geschafft haben. … Und da muss man auch wirklich jedes Mal abwägen: Was kann man noch machen und was auch nicht?“
Die Angehörigen
(Ostfriesland)
Für Sophia und Sarah steht fest: Was man nicht machen kann, das ist so ein Podcast.
Beide Schwestern haben eine diagnostizierte Posttraumatische Belastungsstörung, beide haben unabhängig voneinander die Zeitung kontaktiert. „Ich habe den Reporter nur angeschrieben“, sagt Sophia. Auch andere meldeten sich bei der Zeitung und berichteten von der Belastung der Angehörigen durch den Podcast: ein damaliger Ermittler, ein Mitarbeiter des WEISSEN RINGS in Ostfriesland.
Der Zeitungsverlag reagierte auf die Kritik: Er stoppte die Werbung für den Podcast, er nahm die Plakate ab, er beendete die Social-Media-Kampagne. Er nahm Abstand von der Idee, jede Folge einzeln zu bewerben und zu veröffentlichen.
Nur eines tat der Verlag nicht: Er nahm den Podcast nicht aus dem Netz.
Die Öffentlichkeit
(Mainz und Berlin)
Im Pressekodex des Deutschen Presserats heißt es: „Bei der Berichterstattung über Gewalttaten (…) wägt die Presse das Informationsinteresse der Öffentlichkeit gegen die Interessen der Opfer und Betroffenen sorgsam ab.“ Vor der Abwägung steht aber die Frage: Gibt es überhaupt ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit an einem 16 Jahre zurückliegenden Mord in Ostfriesland oder an einem zwölf Jahre zurückliegenden Mord in Bayern?
Der Mainzer Journalismus-Professor Dr. Tanjev Schultz fordert „strenge Kriterien“ für True-Crime-Beiträge. „Ein Fall muss für die Gegenwart noch etwas bedeuten. Es muss – wieder oder weiterhin – aktuelle Aspekte geben“, schreibt er in einem Gastkommentar für das WEISSER RING Magazin. „Ohne eine Wende in einem Kriminalfall, ohne drängende aktuelle Fragen sind True-Crime-Beiträge oft nur dies: eine Verkaufsmasche.“
„Das persönliche Schicksal von Menschen wird genutzt, um Einschaltquote, Auflage und Klickzahlen zu generieren.“
Wie Schultz sieht der Berliner Medienanwalt Professor Dr. Christian Schertz ein „überwiegendes Informationsinteresse“ nur bei Straftaten der Zeitgeschichte, „die zur DNA der Bundesrepublik gehören“: etwa die RAF-Verbrechen oder die NSU-Morde. Hinter der „großen Zahl der Morde und Tötungsdelikte, die wieder ins Licht der Öffentlichkeit gezogen werden, obwohl sie abgeurteilt und abgeschlossen sind“, erkennt er keine journalistischen Motive, sondern ökonomische: „Das persönliche Schicksal von Menschen wird genutzt, um Einschaltquote, Auflage und Klickzahlen zu generieren“, sagt er im Interview mit dem WEISSER RING Magazin.
Der Chefredakteur
(Ostfriesland)
Lars Reckermann, 54 Jahre alt, hat wenig Zeit. Gestern war er in Berlin, Chefredakteurstagung; heute trifft er sich mit alten Kollegen in Oldenburg; morgen ist große Mitarbeiterversammlung in Leer. Unser Gespräch quetscht er zwischen Berlin und Oldenburg.
Wie alle Tageszeitungschefredakteure treibt Reckermann der Medienwandel um; die Titel der Zeitungsgruppe Ostfriesland haben seit Ende der 90er-Jahre mehr als 40 Prozent ihrer Druckauflage verloren. Deshalb experimentiert er wie so viele andere Chefredakteure mit digitalen Formen. Eine davon heißt Podcast – und der erfolgreichste Podcast der Zeitungsgruppe heißt „Aktenzeichen Ostfriesland“, sagt er begeistert, „mit riesigem Abstand“. Der Verlag verdiene kein Geld damit, er bekomme aber anderes von Wert: junge Menschen unter 40! Eine hohe Durchhör-Quote! Fans, eine Community! „Hier erleben Leute, für die Zeitung nur noch totes Papier ist, dass es uns auf anderen Kanälen gibt. True Crime funktioniert.“
Es gibt also ein Verlagsinteresse an dem 16 Jahre alten Mordfall. Gedeckt wird das laut Reckermann aber von einem Informationsinteresse der Öffentlichkeit: „Ein so außergewöhnlicher Fall gehört zum historischen Gedächtnis der Stadt Leer und zur DNA einer Lokalzeitung.“
Der Chefredakteur sagt aber auch: „Die Kritik der Angehörigen hat uns sensibilisiert, da bleibt etwas hängen. Ich glaube, es wird in Zukunft ein bisschen anders laufen bei uns.“ Wie anders, das weiß er noch nicht.

Bayerischer Rundfunk zieht sich bei True-Crime-Show zurück
Für die Live-Show „Tödliche Liebe“ des Podcast-Duos Jacqueline Belle und Alexander Stevens gab es deutliche Kritik. Jetzt reagiert der Bayerische Rundfunk.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk
(München)
Die Abstimmung mit dem Smartphone. Die Kritik am rechtskräftigen Urteil. Das Mörderinterview aus dem Gefängnis. Der missachtete Wunsch der Zwillingsschwester, den Mord bitte nicht zum Gegenstand der Show zu machen. Verstößt das nicht gegen den Pressekodex? Gegen ein sensibles und ethisches Vorgehen, für das Bayern 3 sich nach eigenen Angaben einsetzt? Schürt das nicht Zweifel am Rechtsstaat?
Wir schicken einen Fragenkatalog an den Bayerischen Rundfunk.
„Im Gegenteil“, antwortet Bayern 3 aus München: „Durch das Programm werden ja gerade Einblicke in unsere Gerichtsbarkeit gewährt, die üblicherweise in dieser Tiefe Nicht-Juristen nicht bekannt sind.“ Die Show zeige, wie das Rechtssystem funktioniere. Die Urteilskritik sei „durch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit“ ebenfalls „Teil des Rechtsstaats“. So wie letztlich auch das Mörderinterview: Bei den dort wiederholten Aussagen handele es sich „um die Wiedergabe eines Teils des Prozesses“.
Die Show biete „juristische Einordnung und Erklärung“, mehr noch: „Durch die einerseits juristisch-journalistische, andererseits sehr empathische Aufbereitung erfährt das schwierige, aber wichtige Thema ,Femizid‘ anhand dieses exemplarischen Falles Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit.“
Es sei „mit einem besonderen Maß an Sensibilität und Fingerspitzengefühl“ gearbeitet worden. Für die Show habe man die Namen von Täter und Opfer geändert, und man zeige inzwischen keine Originalfotos mehr, „um den Wünschen der Familie noch mehr zu entsprechen“. True Crime im Dienste der Allgemeinheit?
Die Angehörigen
(Oberbayern und Ostfriesland)
Es gehe wieder los, sagt Barbara. Seit die Show laufe, versuchten Journalisten, sie zu kontaktieren: über Kollegen, Bekannte, ihre Anwältin. Neue Berichte über den alten Fall erscheinen. „Und dann sitzt man da abends und bricht zusammen. Und der Partner muss einen auffangen.“
Was wünscht sie sich?
„Eine bessere Rechtsgrundlage“, sagt Barbara. „Wenn das Schlimmste passiert, wenn jemand stirbt, dann steht das Opfer nach zehn Jahren ohne Schutz da.“
„Ich wünsche mir, dass der Podcast gelöscht wird“, sagt Sophia.
„Vielleicht wäre schon etwas gewonnen, wenn man es anders machen würde“, überlegt Sarah, ihre Schwester. „Wenn man wenigstens versuchen würde, die Angehörigen zu kontaktieren, bevor man so eine Welle lostritt.“
Es sei doch so, sagt Barbara: „Die haben eine erfolgreiche Show, die schlafen gut. Ich liege nachts wach und muss es aushalten.“
*Namen geändert
Transparenzhinweis:
In der Show „Tödliche Liebe“ wurde bislang auf die Hilfsangebote des WEISSEN RINGS hingewiesen, die Veranstalter sammelten zudem Spenden für den Verein. Der WEISSE RING hatte auf Anfrage von Bayern 3 Informationsmaterial und eine Spendensammelbox zur Verfügung gestellt. Inhalt und Ablauf der Show waren dem Verein zum Zeitpunkt der Anfrage nicht bekannt.
Autor Karsten Krogmann und Lars Reckermann, Chefredakteur der Zeitungsgruppe Ostfriesland, haben zwischen 2016 und 2019 bei der „Nordwest-Zeitung“ zusammengearbeitet.
Ähnliche Beiträge

Bisher nur eine Rüge für True-Crime-Format
Die Rügen des Deutschen Presserats sind in vielen Medienhäusern berüchtigt. True-Crime-Macher mussten sich hingegen bisher kaum Sorgen machen.

Podcasts: Ein boomendes Erfolgsformat
63 Prozent der Befragten gaben in einer Studie an, täglich Podcasts zu hören. Warum das Format so erfolgreich ist, erklärt Vincent Kittmann von OMR.

Exklusive Datenanalyse: Hauptsache tot
Zu True Crime gibt es kaum Daten. Deshalb haben wir versucht, selbst welche zu erheben: mit einer KI-gestützten Analyse von Podcasts und einer Umfrage unter Zeitungen. Ergebnis: In True-Crime-Podcasts geht es fast ausschließlich um Mord und Totschlag.


Teile diesen Beitrag per: