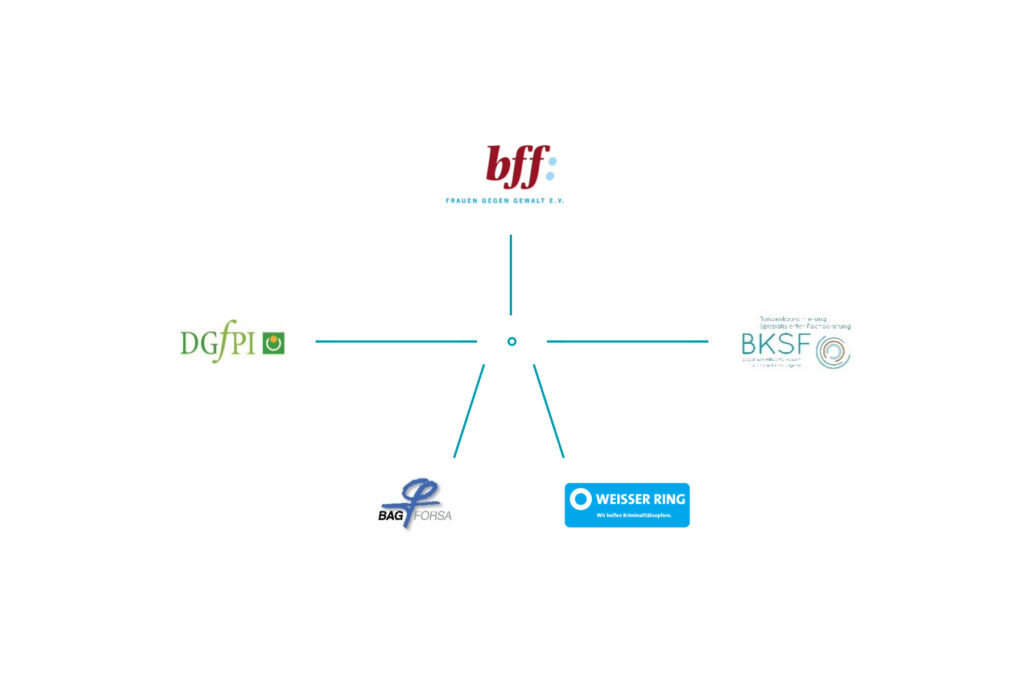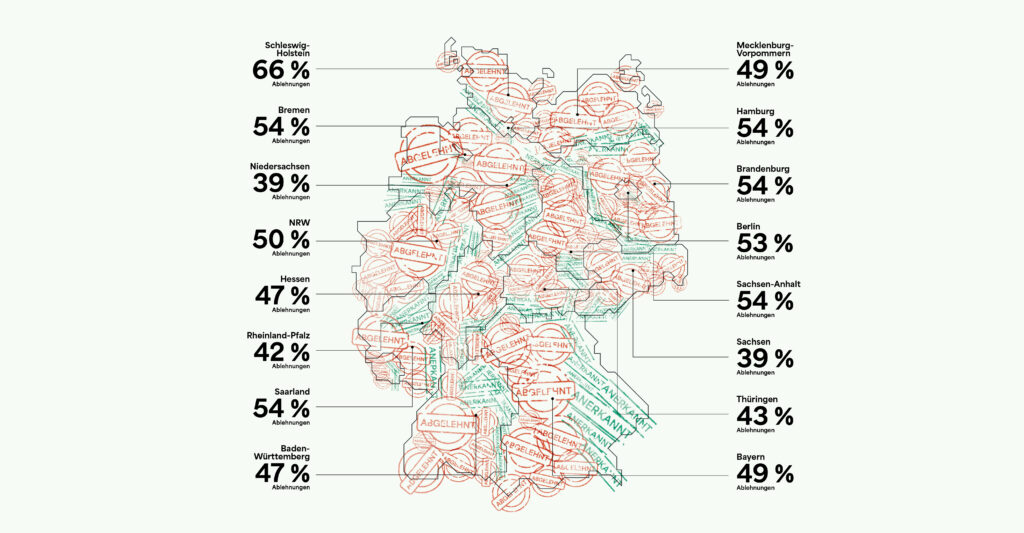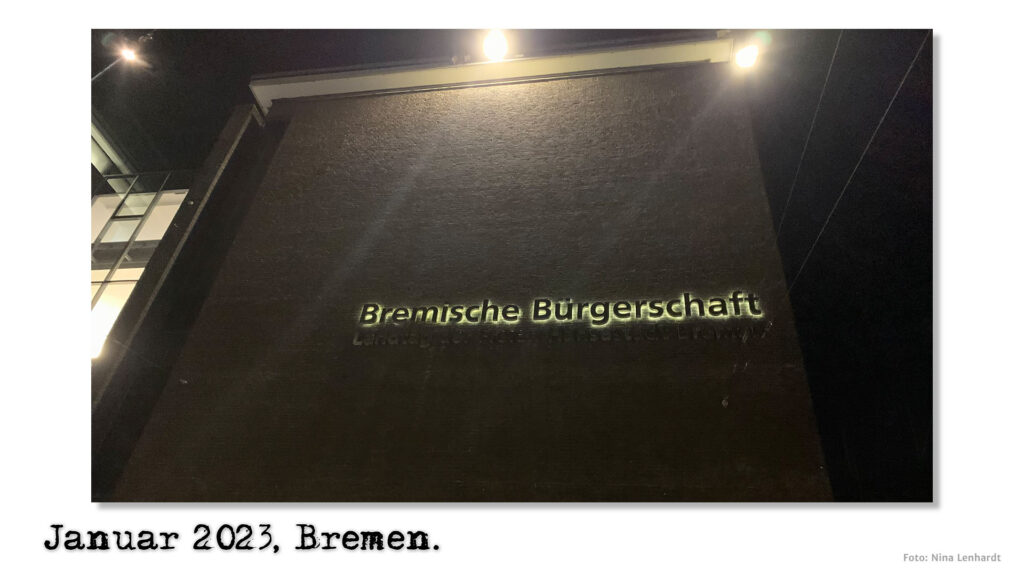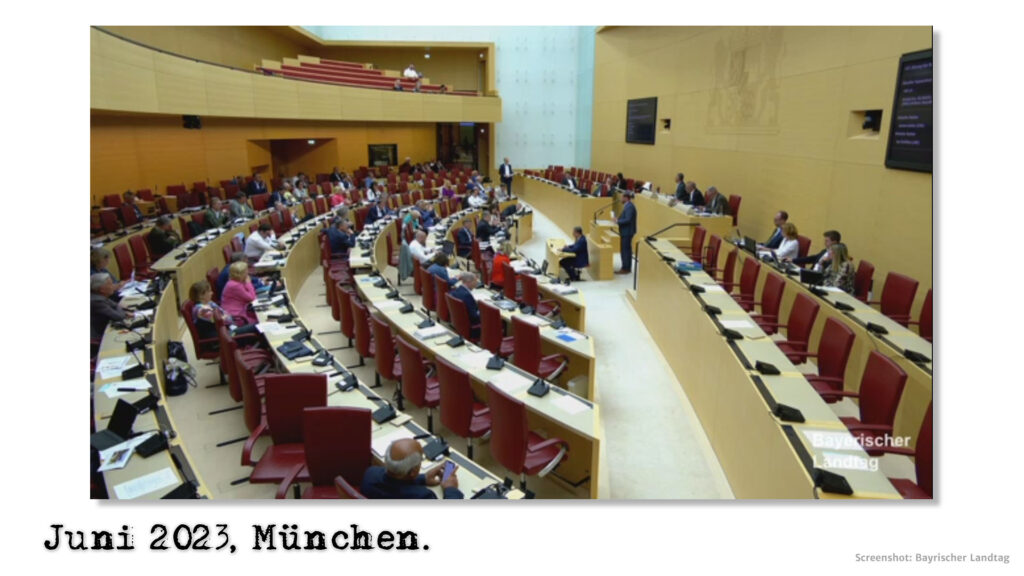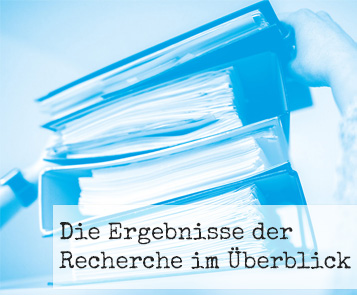Gewalt gegen Frauen
Das Bündnis verspricht, das Gewalthilfegesetz – das ab 2032 einen Rechtsanspruch auf kostenlosen Schutz und Beratung für Frauen und Kinder vorsieht – umzusetzen und die Gewaltschutzstrategie des Bundes zu einem „Nationalen Aktionsplan“ zu erweitern. Die Präventions-, Aufklärungs- und Täterarbeit solle verstärkt werden.
Weiter heißt es im Koalitionsvertrag: „Wir verschärfen den Tatbestand der Nachstellung und den Strafrahmen für Zuwiderhandlungen nach dem Gewaltschutzgesetz und schaffen bundeseinheitliche Rechtsgrundlagen im Gewaltschutzgesetz für die gerichtliche Anordnung der elektronischen Fußfessel nach dem sogenannten Spanischen Modell und für verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings für Täter.“ Den Stalking-Paragraphen will die Koalition um das Verwenden von GPS-Trackern erweitern. Diese werden häufig missbraucht, um Frauen zu belästigen und zu kontrollieren.
Laut den jüngsten Zahlen für häusliche Gewalt waren im Jahr 2023 mehr als 70 Prozent der Betroffenen Frauen und Mädchen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Wert um 5,6 Prozent auf 180.715 (2022: 171.076), teilte das Bundesfamilienministerium mit. Insgesamt wurden 360 Mädchen und Frauen getötet.
Um geflüchtete Frauen besser vor Gewalt zu bewahren, will die Regierung die Residenzpflicht und Wohnsitzauflage lockern. Diese hindern Betroffene oft daran, vom Täter wegzuziehen.
Den Strafrahmen für Gruppenvergewaltigungen möchte die Koalition erhöhen und prüfen, inwiefern sich „offensichtlich unerwünschte und erhebliche verbale und nicht-körperliche sexuelle Belästigungen“ härter bestrafen lassen.
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
Den Fonds Sexueller Missbrauch und das damit verbundene Ergänzende Hilfesystem (EHS), die Betroffenen eine wichtige, niedrigschwellige Unterstützung bieten, „führen wir unter Beteiligung des Betroffenenrats fort“, schreibt die Koalition. In welchem Umfang und unter welchen Bedingungen, ist allerdings noch ungewiss.
Die Umsetzung des UBSKM-Gesetzes (Unabhängige Beauftragte für Sexuellen Kindesmissbrauch) will Schwarz-Rot gemeinsam mit den Ländern, Trägern und Einrichtungen unterstützen, vor allem im Hinblick auf die Pflicht der Institutionen, Missbrauchsfälle aufzuarbeiten und Schutzkonzepte zu schaffen.
Die sogenannten Childhood-Häuser in den Ländern – regionale, interdisziplinäre Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche, die Gewalt erfahren haben – möchte die Koalition mit Bundesmitteln fördern. Im Sorge- und Umgangsrecht soll häusliche Gewalt künftig stärker zu Lasten des Täters berücksichtigt werden; sie stelle eine Kindeswohlgefährdung dar.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die geplante Strategie „Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt“. Ziel sei es, Eltern durch Wissensvermittlung zu stärken und Anbieter in die Pflicht zu nehmen. Schwarz-Rot will sich für eine verpflichtende Altersnachweise und sichere Voreinstellungen bei digitalen Geräten und Angeboten einsetzen.
- Der WEISSE RING begrüßt die Pläne grundsätzlich, betont aber, auch hier sei die konkrete Ausgestaltung entscheidend.
Schutz und Unterstützung für Opfer
Die schon bestehende Kommission zur Reform des Sozialstaates, in der Bund, Länder und Kommunen zusammenarbeiten, wird voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres ihre Ergebnisse präsentieren. Als Ziele geben Union und SPD etwa „Entbürokratisierung“, „massive Rechtsvereinfachung“ und „rascheren Vollzug“ aus. Sozialleistungen könnten zusammengelegt und pauschalisiert werden.
- Der WEISSE RING gibt zu bedenken, dass dies auch zu Sparmaßnahmen und aufgrund der Pauschalisierung zu weniger „Einzelfallgerechtigkeit“ führen könnte.
Die Länge von Gerichtsverfahren soll möglichst verkürzt werden, „indem wir unter anderem den Zugang zu zweiten Tatsacheninstanzen begrenzen“, erklären Union und SPD. Bei Strafprozessen stellt die Koalition einen besseren Opferschutz in Aussicht; die audiovisuelle Vernehmung von minderjährigen Zeugen soll erleichtert werden.
- Nach Auffassung des WEISSEN RINGS kann es je nach Fall sicherlich sinnvoll sein, den Instanzenzug zu begrenzen, es bedeutet aber immer auch eine Beschneidung des rechtlichen Gehörs. Eine Verbesserung des Opferschutzes wäre sehr gut, die genauen Pläne sind aber noch unklar.
Psychotherapeutische Angebote, die auch für Opfer von Straftaten wichtig sind, möchte die kommende Regierung ausbauen, gerade im ländlichen Raum. Dazu plant sie zum Beispiel eine Notversorgung durch Psychotherapeuten, wohnortnahe psychosomatische Institutsambulanzen und mehr digitale Behandlungsmöglichkeiten. Ein wesentliches Ziel sei, die Resilienz von Kindern und Jugendlichen zu stärken.
Innere Sicherheit
Die Koalition kündigt eine „Sicherheitsoffensive“ an, mithilfe von „zeitgemäßen digitalen Befugnissen“ und ausreichend Personal in den Behörden.
Zu den angekündigten Maßnahmen zählt eine dreimonatige Speicherpflicht für IP-Adressen und Portnummern, um Anschlussinhaber identifizieren zu können. Die Telefonüberwachung beim Wohnungseinbruchsdiebstahl soll leichter, die Funkzellenabfrage umfassender möglich sein.
Ein weiteres Vorhaben hängt mit Anschlägen wie in Mannheim und Aschaffenburg in diesem Jahr zusammen: „Zur Verhinderung weiterer Gewalttaten, wie in der jüngsten Vergangenheit, wollen wir die frühzeitige Erkennung entsprechender Risikopotenziale bei Personen mit psychischen Auffälligkeiten sicherstellen. Hierzu führen wir eine gemeinsame Risikobewertung und ein integriertes behördenübergreifendes Risikomanagement ein.“
Um im Vorfeld Terrorangriffen, die mit „Alltagsgegenständen“ begangen werden, besser entgegenzuwirken, will Schwarz-Rot die Anwendung von Paragraf 89a im Strafgesetzbuch (StGB) – Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat – ausweiten: auf den Fall, dass der Täter keinen Sprengstoff, sondern Gegenstände wie ein Messer oder ein Auto benutzen will.
Mit „allen Betroffenen und Experten“ beabsichtigt die Koalition, das Waffenrecht zu evaluieren und gegebenenfalls zu ändern, um zu verhindern, dass Menschen illegal Waffen besitzen oder Extremisten und Menschen „mit ernsthaften psychischen Erkrankungen“ sich legal welche beschaffen können. Bei möglichen Gesetzesänderungen gilt: Das Recht soll „anwenderfreundlicher“ werden, zudem müsse bei den Vorgaben die „Verhältnismäßigkeit“ gewahrt bleiben.
- Um Amokläufe mit Waffen zu unterbinden, werden die Maßnahmen wohl nicht reichen, befürchtet der WEISSE RING.
Im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität strebt die Koalition eine vollständige Beweislastumkehr beim Einziehen von Vermögen an, dessen Herkunft nicht geklärt ist.
Ausländische Personen, die schwere Straftaten begehen und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden, sollen in der Regel ausgewiesen werden, etwa bei Delikten gegen Leib und Leben, die sexuelle Selbstbestimmung oder bei einem tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte.
Zu den Ursachen der gestiegenen Kinder- und Jugendgewalt ist eine Studie, die auch mögliche Gesetzesänderungen untersucht, geplant.
Digitale Gewalt
Die Koalition verspricht ein „umfassendes Digitales Gewaltschutzgesetz“. Damit wolle sie die rechtliche Stellung von Betroffenen verbessern und Sperren für anonyme „Hass-Accounts“ ermöglichen. Sie will zudem prüfen, ob Opfer und Zeugen in Strafverfahren darauf verzichten können, ihre Anschrift anzugeben, wenn die Verteidigung Akteneinsicht beantragt.
Im Cyberstrafrecht gelte es, Lücken zu schließen, beispielsweise bei „bildbasierter sexualisierter Gewalt“. Das Gesetz soll auch Deepfake-Pornografie erfassen, bei der Bilder von Gesichtern prominenter und nicht-prominenter Menschen mit Hilfe von KI auf andere Körper montiert werden.
Online-Plattformen sollen „Schnittstellen zu Strafverfolgungsbehörden“ zur Verfügung stellen, damit Daten, die für Ermittlungsverfahren relevant sind, „automatisiert und schnell“ abrufbar sind. Die Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Plattformen, die strafbare Inhalte nicht entfernen, sollen verschärft werden.
Angriffe auf die Demokratie
Die Koalition kündigt an, allen verfassungsfeindlichen Bestrebungen entschlossen entgegenzutreten, egal ob Rechtsextremismus, Islamismus, auslandsbezogenem Extremismus oder Linksextremismus.
Hierzu planen die Parteien unter anderem, den Tatbestand der Volksverhetzung zu verschärfen. Wer zum Beispiel mehrfach deswegen verurteilt wird, könnte in Zukunft das passive Wahlrecht verlieren. Zudem will Schwarz-Rot eine Strafbarkeit für Amtsträger und Soldaten prüfen, die in geschlossenen Chatgruppen in dienstlichem Zusammenhang antisemitische und extremistische Hetze teilen. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Fälle, die straffrei blieben: Gerichte vertraten die Auffassung, es handele sich um private Gruppen, wo es nicht strafbar sei, solche Inhalte zu verbreiten.
In den vergangenen Jahren haben die Angriffe auf Mandatsträger, Rettungs- und Einsatzkräfte sowie Polizisten deutlich zugenommen. Bei den politischen Amts- und Mandatsträgern stiegen die von der Polizei erfassten Attacken 2024 um 20 Prozent auf 4923. Deshalb wollen Union und SPD den „strafrechtlichen Schutz“ solcher Gruppen prüfen und eventuell erweitern. Darüber hinaus soll das Melderecht überarbeitet werden, um die Privatsphäre der Betroffenen besser zu schützen.
Zum zunehmenden Rechtsextremismus – allein bis zum 30. November 2024 wurden 33.963 Delikte im Bereich „politisch motivierte Kriminalität – rechts“ und damit so viele wie noch nie registriert – schreibt die Koalition lediglich allgemein: „Der Polarisierung und Destabilisierung unserer demokratischen Gesellschaft und Werteordnung durch Rechtspopulisten und -extremisten setzen wir eine Politik der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Vielfalt, Toleranz und Humanität entgegen.“ Abgesehen von einem NSU-Dokumentationszentrum in Nürnberg werden kaum konkrete Maßnahmen genannt.
Im Kampf gegen Islamismus ist ein „Bund-Länder-Aktionsplan“ vorgesehen, zudem soll die „Task Force Islamismusprävention“ ein festes Gremium im Bundesinnenministerium werden und helfen, den Aktionsplan umzusetzen.
Mit Vereinen und Verbänden, die direkt oder indirekt von ausländischen Regierungen gesteuert und vom Verfassungsschutz beobachtet würden, werde der Bund nicht zusammenarbeiten. Sie sollen verpflichtet werden, offenzulegen, wie sie sich finanzieren.
Als weiteres Ziel gibt die Koalition die Sicherheit jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger an, sowohl im digitalen als auch im öffentlichen Raum, etwa an Schulen und Hochschulen. Hierzu sollen unter anderem Lehrer darin geschult werden, Antisemitismus zu erkennen und dagegen vorzugehen.
Projekte zur demokratischen Teilhabe sollen weiterhin vom Bundesförderprogramm „Demokratie leben!“ profitieren.
Diskriminierung
Die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle soll fortgeführt, der Nationale Aktionsplan gegen Rassismus so überarbeitet werden, dass dieser „in seinen verschiedenen Erscheinungsformen“ bekämpft werden könne. Einen besonderen Schutz verspricht die Koalition nationalen Minderheiten, etwa der dänischen Minderheit oder den deutschen Sinti und Roma. Außerdem sollen alle unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung „gleichberechtigt, diskriminierungs- und gewaltfrei“ leben können. Dazu, heißt es, „wollen wir mit entsprechenden Maßnahmen das Bewusstsein schaffen, sensibilisieren und den Zusammenhalt und das Miteinander stärken“. Wie genau all dies geschehen soll, steht nicht im Vertrag.
Zwischen 2021 und 2023 waren mehr als 20.000 Fälle von Diskriminierung bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gemeldet worden. Die Unabhängige Bundesbeauftragte, Ferda Ataman, kritisierte, das deutsche Antidiskriminierungsrecht sei unzureichend.
Menschenhandel
“Deutschland ist zu einer Drehscheibe beim Menschenhandel geworden“, die Opfer seien fast ausschließlich Frauen, schreibt die Koalition am Anfang ihres Kapitels zum Prostituiertenschutzgesetz. Eine Evaluation über die Wirkung des Gesetzes soll bis Juli dieses Jahres vorgestellt werden. Bei Bedarf will das schwarz-rote Bündnis auf eine Experten-Kommission zurückgreifen, um gesetzlich nachzubessern.
- Dass sich die Koalition dem Thema widmen will, ist nach Ansicht des WEISSEN RINGS positiv, aber auch hier ist die konkrete Umsetzung noch unklar.
Zu anderen Formen von Menschenhandel, etwa zur Ausbeutung der Arbeitskraft, sagt die Koalition nichts. Aus dem letzten Lagebild des Bundeskriminalamtes zu Menschenhandel und Ausbeutung geht hervor, dass 2023 319 Verfahren wegen sexueller Ausbeutung, 37 wegen Arbeitsausbeutung und 204 wegen Ausbeutung Minderjähriger geführt wurden. Experten gehen in diesem Bereich von einer hohen Dunkelziffer aus. Ein Grund dafür ist, dass Betroffene unter anderem aus Angst vor ihren Ausbeutern nur selten Anzeige erstatten.