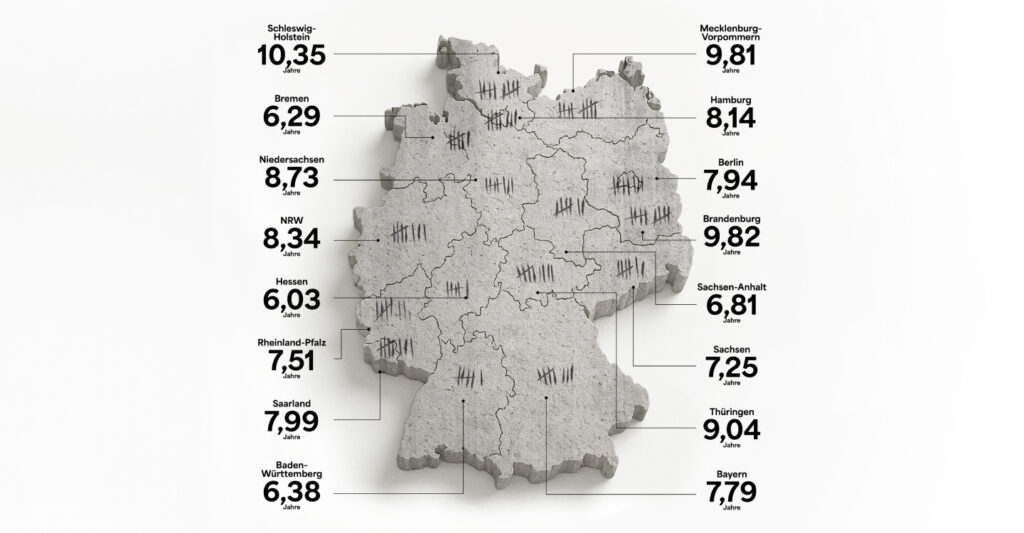Viele Opfer haben sich vergeblich überwunden und einen Antrag auf Unterstützung gestellt. Foto: dpa
Datum: 11.07.2025
Nach Aus für Missbrauchsfonds: „Stille und Entsetzen“ bei den Betroffenen
Der rückwirkende Antragsstopp beim Fonds Sexueller Missbrauch hat bei Opfern und Beratenden Empörung ausgelöst.
Sabrina Lange* wurde mehrfach missbraucht und ist dadurch schwer traumatisiert. So schwer, dass sie unter anderem an Krampfanfällen leidet. Um ihren Alltag zu erleichtern und ihrer Belastungsstörung besser entgegenwirken zu können, wollte sie ihren dafür gut geeigneten Hund zum Assistenzhund ausbilden lassen. Sie hoffte dabei auf eine Finanzierung durch den Fonds Sexueller Missbrauch (FSM). Zusammen mit Ingeborg Altvater, die ehrenamtlich für den WEISSEN RING arbeitet, hatte sie in den vergangenen Wochen einen Antrag vorbereitet, gewissenhaft Informationen gesammelt und Formulare ausgefüllt.
Vor wenigen Tagen, kurz vor dem Fertigstellen des Antrags, rief Altvater Sabrina Lange an, um ihr eine schlechte Nachricht zu überbringen: Der Fonds wird zumindest vorerst kein Geld mehr auszahlen. Als Lange das hörte, schwieg sie. Nach einer langen Pause fragte sie: „Was mache ich jetzt?“ Altvater konnte ihr keine zufriedenstellende Antwort geben. Denn einen Assistenzhund etwa über das Soziale Entschädigungsrecht zu finanzieren, ist nur schwer möglich, und wenn, dann dauert es jahrelang.
Nach dem Stopp beim Fonds – rückwirkend zum 19. März – hat Altvater wiederholt Reaktionen wie die von Sabrina Lange erlebt, wie sie im Gespräch mit dem WEISSER RING Magazin erzählt. Sie berät zum Ergänzenden Hilfesystem (EHS), dessen Teil der Fonds ist, und begleitete Opfer hierbei in mehr als 100 Fällen. Altvater bezeichnet die aktuelle Entwicklung als „Katastrophe“. Dass sie die Betroffenen nach und nach anrufen und informieren musste, habe ihr „in der Seele wehgetan“. Am anderen Ende der Leitung habe „Stille und Entsetzen“ geherrscht. Alleine in Hessen, wo die ehrenamtliche Mitarbeiterin im Einsatz ist, hätten in acht bis zehn Fällen Beratungstermine kurzfristig abgesagt werden müssen. Und dass, obwohl bei denen der Antrag fast fertig gewesen sei. Andere Verfahren – bei denen die Betroffenen teils weite Wege und die erneute Konfrontation mit dem Missbrauch auf sich genommen hätten – liefen schon und nach jetzigem Stand vergeblich.
Fonds ist wichtige niedrigschwellige Hilfe
Die Sprachlosigkeit sei für einen Teil der Missbrauchsopfer typisch, sie gehörten zu den Schwerstbetroffenen, fühlten sich wehrlos und könnten nur schwer ihre Stimme erheben, um sich für ihre Belange einzusetzen. Umso schlimmer sei der Umgang mit ihnen – zumal es nicht um Milliardensummen gehe, kritisiert Altvater.
Vor zwei Wochen hatte die Geschäftsstelle des FSM auf ihrer Webseite mitgeteilt, dass sie Erstanträge, die ab dem 19. März dieses Jahres eingegangen sind, voraussichtlich nicht mehr annehmen könne. Die Mittel im Bundeshaushalt reichten nicht, hieß es.
Der Fonds ist für viele Betroffene eine niedrigschwellige Unterstützung, auf die sie nicht verzichten können. Er kann einspringen, wenn Behandlungen, etwa Physio- oder Ergotherapie, oder andere Leistungen nicht von Kranken- und Pflegekassen oder dem Sozialen Entschädigungsrecht abgedeckt werden. Nach Angaben des zuständigen Bundesfamilienministeriums haben bislang 36.000 Betroffene einen Antrag gestellt, ausgezahlt wurden 165,2 Millionen Euro.
Ministerin Prien kündigt an, sich für mehr Geld einzusetzen
Ministerin Karin Prien (CDU) kündigte an, sie werde sich im Bundestag für zusätzliche Haushaltsmittel für Opfer von Kindesmissbrauch engagieren und das System neu aufstellen. Doch ob und wann die Reform kommt, und wie viel Geld dafür zur Verfügung steht, ist ungewiss.
Bereits im Frühjahr war bekanntgeworden, dass der Fonds auslaufen soll. Das damals von Lisa Paus (Grüne) geführte Familienministerium führte haushaltsrechtliche Bedenken des Bundesrechnungshofes als Grund an und sah die künftige Regierung in der Pflicht, für Ersatz zu sorgen. In seinem Koalitionsvertrag versicherten Union und SPD zwar: „Den Fonds sexueller Missbrauch und das damit verbundene Ergänzende Hilfesystem führen wir unter Beteiligung des Betroffenenrats fort.“ Aber es kam anders.
Nach dem angekündigten Auslaufen des Fonds im März rief Ingeborg Altvater Betroffene, die bereits erste Kontakte wegen einer Antragstellung zu ihr aufgenommen hatten, an und klärte sie darüber auf. Daraufhin wurden einige von ihnen aktiv und stellten noch einen Antrag. Manche machten sich nun den Vorwurf, sie hätten zu lange gewartet. Zu Unrecht, sagt Altvater. Sie könnten nichts für den Stopp, der auch noch rückwirkend erfolgt sei. Manche Opfer kämpften jahrzehntelang mit den Folgen des Missbrauchs, sie bräuchten viel Kraft und Zeit, um sich zu einem Antrag auf Unterstützung durchzuringen.
Schlag ins Gesicht für traumatisierte Menschen
Susanne Seßler, die sich für den WEISSEN RING vor allem in Südbayern als EHS-Beraterin engagiert, macht derzeit ähnliche Erfahrungen wie Altvater und spricht von einem Schlag ins Gesicht. „Erschüttert“ seien die Betroffenen. Sie hätten sich überwunden und würden nun wieder „hinten herunterfallen“, was bei traumatisierten Menschen besonders schlimm sei. „Manche sagen bitter enttäuscht: ,Sehen Sie, ich wusste, dass ich nichts bekomme‘“, berichtet Seßler. In den vergangenen Monaten habe sie zusammen mit Betroffenen knapp 20 Anträge fertiggestellt, etwa fünf weitere seien geprüft und noch mehr vorbereitet worden.
Dass das Geld nicht reiche, kann Seßler nicht nachvollziehen: Zum einen hätten die Verantwortlichen nach ihrer Mitteilung im März damit rechnen müssen, dass aufgrund der Befristung mehr Anträge kommen. Zum anderen lägen diese geschätzt im vierstelligen Bereich, so dass sich die Ausgaben bei einer Unterstützung von in der Regel 10.000 Euro in Grenzen hielten.
Zwei Frauen, die Seßler beriet, wurde eine Reittherapie genehmigt, die allerdings von der Therapeutin verschoben werden musste. „Was jetzt? Wird das Geld noch ausgezahlt?“, fragen sich die Betroffenen.
Neuer Missbrauchsfonds gefordert
Seßler fordert, kurzfristig die entstandenen Lücken mit zusätzlichem Geld zu schließen und mittelfristig einen neuen Fonds aufzusetzen. Das neue Soziale Entschädigungsrecht, das seit 2024 gilt, sei nicht umfassend genug, um die „wichtigen Komplementärtherapien“ abzudecken.
Der WEISSE RING und vier weitere Fachorganisationen – die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung, der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, die Bundeskoordinierung Spezialisierter Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend sowie der Bundesarbeitsgemeinschaft Feministischer Organisationen gegen Sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen – haben den Stopp kürzlich in einer gemeinsamen Erklärung scharf kritisiert. Sie forderten, die Hilfen zu erhalten und das dafür nötige Geld im Etat des Bundes bereitzustellen.
Auch Ingeborg Altvater hofft noch. Sie hat die Opfer gebeten, ihre Unterlagen aufzuheben.
*Name geändert