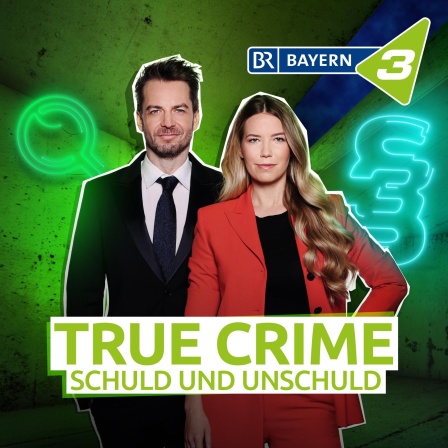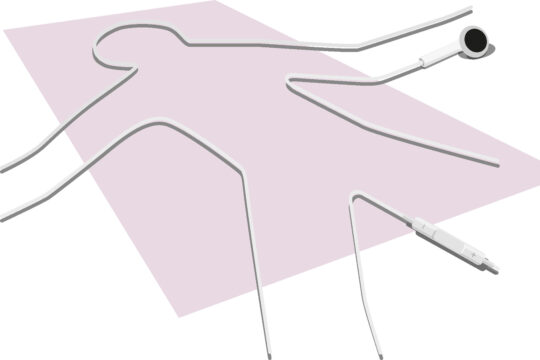Sensationsgier statt Sensibilität
Sandra Epps Eltern wurden ermordet. Doch anstatt in Ruhe zu trauern, stürzen sich die Medien auf den Fall, da der Täter der Nachbar des Ehepaars war. Monatelang muss die Familie private Fotos, despektierliche Überschriften und falsche Angaben in Zeitungen ertragen. Jetzt möchte sie ihre Wirklichkeit erzählen, um die Würde ihrer Eltern wiederherzustellen.

Vor drei Jahren wurden Sandra Epps Mutter und Stiefvater vom Nachbarn erschossen.
Kilometerlange Alleen führen zum Haus von Sandra Epp, es ist eine ruhige Gegend. Ein Bus kommt nur selten vorbei. Jedes Haus hat seinen eigenen Charakter, keines gleicht dem anderen. Alle Zäune sind aber auf einer Höhe, die Gärten millimetergenau gemäht, jede Hecke ist perfekt gestutzt. Das Haus der 37-Jährigen fällt durch die rosa Fassade auf. Eine kleine Bank steht vor der Eingangstür.
Genau hier wartete vor drei Jahren ein Polizist darauf, dass Sandra Epp ihm die Tür öffnete, wie sie im Gespräch mit dem WEISSER RING Magazin erzählt. Sie wusste damals nicht, was los ist. Dann die Nachricht: Ihre Mutter (61) und ihr Stiefvater (62) wurden erschossen. Der Täter, ein Jäger, war der Nachbar des Ehepaares. Er hat sich nach der Tat das Leben genommen. Sie informierte ihre 21-jährige Schwester, die gerade Nachtdienst hatte.
Ein Gewaltdelikt, das unzählige Medien auf den Plan rief. „85-jähriger Jäger erschießt Nachbar-Ehepaar: ‚Es ärgerte ihn, dass das Paar nackt durch den Garten lief‘“ betitelt der „Merkur“ seinen Bericht. Andere Medien greifen das Narrativ des „nackten Ehepaares im Garten“ auf. Mehrere Anfragen an die „Merkur“-Redaktion, wieso diese Überschrift gewählt wurde, blieben ohne Antwort.
Wie haben Sie die mediale Berichterstattung wahrgenommen, Frau Epp?
Uns war es zu viel. So viele Bilder wurden veröffentlicht. Warum immer so viele Fotos? Das Haus, der Garten, der Wohnwagen, die Blutlache und auch ein Bild meiner Mutter wurden veröffentlicht. Reicht nicht ein Titelbild? Auch wurde der Name meiner Mutter falsch geschrieben oder das Alter, Tatsachen wurden verdreht. Beispielsweise durch das Zitieren von Nachbarn, die angaben, meine Eltern hätten den Täter provoziert.
Indem sie laut Musik gehört hätten und nackt im Garten herumgelaufen seien.
Ich kann mir bei den beiden nicht vorstellen, dass sie nackt im Garten gewesen wären. Und selbst wenn: Es ist ihr Garten, sie dürfen machen, was sie für richtig halten. Das ist kein Grund, jemanden zu ermorden. Die Polizei vor Ort konnte uns den Ablauf der Tat anfangs nicht sagen. Erst hieß es, ihnen wurde in den Bauch geschossen – aber es war der Brustkorb.
Sandra Epp macht eine kleine Pause. Sie ist eine sportliche Frau mit blondem Haar. Ihre hellbraunen Augen wirken kraftvoll. Und so erzählt sie auch weiter.
Das war für uns damals ganz schwierig, wir wussten nicht, was wir glauben sollten. Wir wurden gefragt, ob wir die Leichen sehen möchten und machten den Fehler, nein zu sagen. Der Schock saß noch zu tief. Jetzt fehlt uns das reale Bild, um die Tatsache besser begreifen zu können: Dass sie plötzlich einfach weg sind.
In den Artikeln wurde immer wieder von einem Nachbarschaftsstreit geschrieben, der aufgrund der Lautstärke ihrer Eltern entstanden sei und weil der Nachbar einen Baum auf seinem Grundstück fällen sollte. Frau Epp, Sie meldeten sich beim WEISSER RING Magazin, weil Sie erzählen wollten, wie es wirklich gewesen sei. Wie sieht die Wahrheit aus Ihrer Sicht aus?
Es gab immer wieder Schwierigkeiten. Vieles ärgerte den Mann. Die Polizei fand sogar einen Hefter, in dem er jedes seiner Meinung nach falsche Verhalten mit Datum und Uhrzeit notierte. Während eines Sturms stürzte ein Baum auf ein Häuschen im Garten meiner Eltern, das neben dem Haupthaus stand. Die Feuerwehr warnte sie vor einem Baum auf seinem Grundstück; beim nächsten starken Sturm könnte er ihr Haus treffen, hieß es. Der Täter weigerte sich aber, den Baum entfernen zu lassen, und so gingen sie vor ein Schiedsgericht.

Der Wohnort von Sandra Epp ist ruhig, Felder schmücken die Gegend. In der Idylle lässt es sich leicht vergessen, was die junge Frau erlebte.
Die 37-Jährige steht auf und kommt mit einem großen weißen Ordner zurück. Sie lässt ihn auf ihr Sofa fallen. Zwischen Dutzenden Unterlagen kramt sie ein Schreiben von der zuständigen Staatsanwaltschaft hervor. Es beinhaltet eine achtseitige Zusammenfassung des Ermittlungsverfahrens und bestätigt ihre Aussagen.
Eine polizeiliche Erkenntnis waren Anrufe des Täters bei der Polizei. Von 2018 bis 2020 beschwerte er sich insgesamt dreimal wegen Ruhestörung. Immer, weil das Ehepaar laute Musik gehört habe. 2022, genau drei Monate vor der Tat, rief er die Polizei, weil er glaubte, sein Nachbar habe sein Brennholz manipuliert. Die Polizei stellte nichts fest. Die Schwester des Täters sagte gegenüber der Polizei, er sei über die Jahre depressiv geworden. Seine langjährige Partnerin verließ ihn 2021.
Im Jahr 2023 erschien ein Podcast der „BILD“-Zeitung über den Fall. In einem eher lockeren Ton besprechen die Moderatoren die Tat. Es werden Nachbarn zitiert, die Epps Eltern als provokant darstellen, und der Sprecher beschreibt den Tattag auf Grundlage von Vermutungen. „Lasst uns also Folgendes spekulieren: Sie setzen sich zu Mittag raus, vielleicht wird bei dem schönen Wetter der Grill angeschmissen. Dazu ein kühles Bierchen oder ein kleines Sektchen geöffnet. Die beiden unterhalten sich angeregt. Lachen laut. Ein Hohn in den Ohren des Täters“, erzählt er.
„Ich habe das Gefühl, etwas richtigstellen zu müssen, um die Würde unserer Eltern wiederherzustellen“
Sandra Epp
Besonders dieser Podcast macht Sie wütend. Wieso?
Sie haben in dem Podcast eine Geschichte erzählt, die nicht stimmen kann. Ich hatte an dem Tag mit meiner Mutter telefoniert. Um 11:40 Uhr habe ich sie angerufen und mit ihr über die geplante Geburtstagsfeier meines Sohnes gesprochen und wann sie dafür zu uns kommen wollen. Sie erzählte nichts von einem erneuten Streit mit dem Nachbarn. Sie sagte zu mir, dass sie bei dem schönen Wetter gleich die Bettwäsche zum Trocknen aufhängen wird – dann trocknet sie schneller.
Sandra Epp atmet kurz durch.
Wir wissen den genauen Hergang auch nicht, aber mein Stiefvater muss am Wohnwagen gebastelt haben; sicher, um ihn für die Fahrt zu uns vorzubereiten. Nachbarn sahen ihn kurz vorher noch im Garten. Gegen 12 Uhr haben wir das Telefonat beendet, und um 12:15 Uhr wurden sie erschossen. Als ich am Haus ankam, sah ich noch die Blutlache. Das sind Bilder, die wird man nie wieder los. Auf einem Stuhl lag ein Teil der Bettwäsche, ein anderer hing an der Leine.
Im Ermittlungsbericht, der dem WEISSER RING Magazin vorliegt, steht, dass die Leiche des Stiefvaters an der Vorderseite des Gebäudes gefunden wurde, in der Nähe des Carports. Ihre Mutter wurde im hinteren Bereich des Wohnhauses gefunden. Das Telefonat erwähnte Epp auch gegenüber der Polizei. Eine Nachbarin sagte aus, kurz vor der Tat mit dem Ehepaar gesprochen und eine angespannte Situation wahrgenommen zu haben. Bei dem Gespräch ging es laut Aussage auch um den Nachbarschaftsstreit. Vom Grillen oder Alkoholkonsum steht im Bericht nichts. Den genauen Tathergang kennt aber nur der Täter.
In dem „BILD“-Podcast fanden sich weitere für Sandra Epp unerträgliche Stellen. Die Moderatorin zieht Parallelen zu einem bekannten Nachbarschaftsstreit wegen eines Maschendrahtzauns. Der Moderator Stefan Raab produzierte damals dazu einen gleichnamigen Song, der im Podcast fröhlich gesungen wurde. Hinzu kamen Stellen, die für Epp eine Mitschuld der Opfer an der Tat suggerierten: „Ich denke, es ist auch ein Appell an uns alle, dass wir mehr aufeinander achtgeben müssen“, sagt der Sprecher.
Die WR-Redaktion hat den Verlag mit Epps Vorführen konfrontiert. „Der Persönlichkeitsschutz von Opfern hat bei unseren True-Crime-Produktionen höchste Priorität. Wir achten stets darauf, die dahingehenden Rechte aller beteiligten Personen zu wahren und die Fakten der Fälle wahrheitsgemäß wiederzugeben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir redaktionelle Prozesse und Entscheidungen darüber hinaus nicht kommentieren“, antwortet eine „BILD“-Sprecherin.
Epp zweifelt an der Priorität. Es reiche nicht aus, einfach die Namen der Opfer zu ändern.
Warum haben Sie sich nicht schon damals gemeldet, um Ihre Sicht der Dinge darzustellen?
Damals war ich völlig überfordert durch die ganzen unterschiedlichen Medienberichte, die Fotos und den Polizeibericht. Es gab Presseanfragen, aber wir lehnten alle ab. Jetzt gehe ich schon lange in Therapie, bin gestärkt und habe den Mut gefasst. Ich habe das Gefühl, etwas richtigstellen zu müssen, um die Würde unserer Eltern wiederherzustellen. Ich bin eine Hinterbliebene, daher würde ich mir mehr Gerechtigkeit für Hinterbliebene wünschen. Wir sind auch Opfer, wir müssen lernen, damit zu leben, mit den ganzen Bildern und Reportagen. Es macht mich wütend, dass Gaffer teilweise 5.000 Euro Strafe zahlen müssen, aber am Ende wird alles im Internet freigegeben. Betroffene kennen die Gesetzeslage nicht, um sich richtig wehren zu können. Hätte ich vieles früher gewusst, hätte ich früher gehandelt.
Sandra Epp klappt den weißen Ordner zu. Dann steht sie auf und geht eine Zigarette rauchen.
Was Angehörige bei rechtswidriger Berichterstattung machen können
Wenn ein Bild einer verstorbenen Person innerhalb von zehn Jahren nach ihrem Tod ohne die Zustimmung der Angehörigen veröffentlicht wurde, können diese rechtlich dagegen vorgehen. In solchen Fällen besteht ein Unterlassungsanspruch, der gerichtlich durchgesetzt werden kann. Angehörige können zudem verlangen, dass bereits veröffentlichte Bilder entfernt werden, etwa aus Artikeln, TV-Beiträgen oder Internetseiten. In besonders schweren Fällen – etwa bei entstellender oder menschenunwürdiger Darstellung – kann auch eine Geldentschädigung gefordert werden. Darüber hinaus ist es möglich, Beschwerden bei Landesmedienanstalten, dem Presserat oder Datenschutzbehörden einzureichen. Generell ist es schwer, gegen True-Crime-Formate vorzugehen, da mit dem Tod das allgemeine Persönlichkeitsrecht endet. Danach gilt nur noch ein postmortaler Achtungsanspruch. Dieser verbietet lediglich grobe Verzerrungen oder würde verletzende Darstellungen.

Ungefragt ausgenutzt
True Crime boomt – das Publikum ist fasziniert, doch für Hinterbliebene wird der Hype oft zum Albtraum.