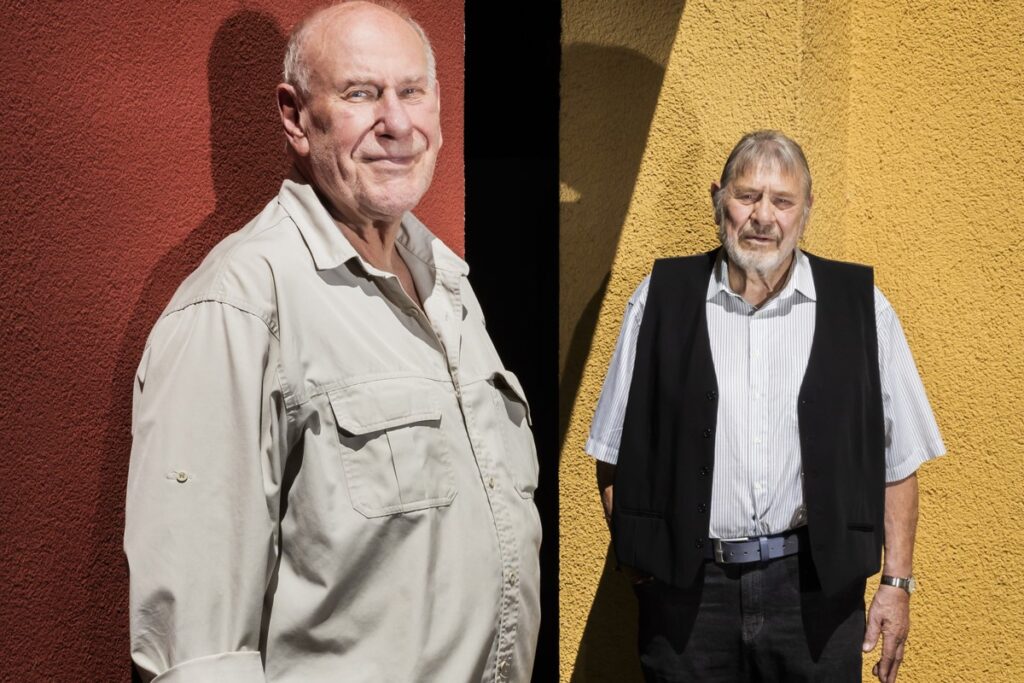Viele Politikerinnen und Politiker berichten von massiver analoger und digitaler Gewalt, zunehmend auch im kommunalen Bereich. In der Stadt Neubrandenburg hat jüngst ein Bürgermeister aus diesem Grund sein Amt niedergelegt. Was kann, was muss der Staat tun, um diese Menschen und ihre Ämter besser zu schützen?
Es ist ja schon einiges geschehen. Erst im Sommer hat die „Starke Stelle“ ihre Arbeit aufgenommen, das ist eine bundesweite Ansprechstelle für kommunale Amts- und Mandatsträgerinnen und -träger. Betroffene Politiker können sich dort individuell beraten lassen. In Brandenburg gibt es außerdem ein mobiles Beratungsteam: Als in meiner Kommune eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden sollte, gab es viel Widerstand. Das Beratungsteam hat dann alle an einen runden Tisch geholt und dazu eingeladen, sachlich miteinander zu reden.
Das Innenministerium in Brandenburg hat zudem eine Umfrage unter kommunalen Mandatsträgern gemacht, um faktenbasiert herauszufinden, wie viel Gewalt die wirklich erleben – und von wem sie angegriffen werden. Spannenderweise sind es manchmal nicht nur die Bürger, die Politiker bedrohen, sondern auch Kollegen aus den eigenen oder anderen Fraktionen.
Was kann, was muss eine Opferschutzorganisation wie der WEISSE RING tun, um Politikerinnen und Politiker zu schützen?
Im Bereich der Politik geht es oft um verbale Taten, körperliche Angriffe sind zum Glück eher die Ausnahme. Viele, die im Netz angegriffen werden, möchten vor allem geschützt werden. Es ist aber nicht immer leicht zu sagen, ab wann eine Aussage justiziabel ist und wann nicht. Das können wir auch nicht entscheiden. Der WEISSE RING versteht sich als Lotse im Hilfesystem, und dazu gehört, auf Angebote wie die „Starke Stelle“ zu verweisen, deren Netzwerkpartner wir auch sind. Außerdem gibt es noch spezialisierte Institutionen wie HateAid, die sehr erfahren sind im Umgang mit digitaler Gewalt und Betroffenen gut helfen können.
Wäre es ein hilfreiches Mittel gegen digitale Gewalt, wenn jeder sich nur noch mit dem Klarnamen im Internet anmelden dürfte?
Das würde ich mir wünschen. Ich glaube aber, dafür ist es schon zu spät, das haben wir verpasst. Bei unserer Bundesdelegiertenversammlung im September hat der Faktenchecker Oliver Klein vom ZDF über Hass im Netz berichtet und gesagt: „Die Lüge ist dreimal um die Welt, bevor die Wahrheit ihre Schuhe angezogen hat.“ Ich fürchte, wir werden das Problem nicht von heute auf morgen in den Griff bekommen. Deshalb ist es wichtig, auf Prävention zu setzen, vor allem bei der jüngeren Generation, die ja schon ganz anders mit digitalen Medien aufwächst.
Digitale Gewalt ist ein recht junges Tatphänomen. Meinten Sie das, als Sie vor Ihrer Wahl ankündigten, der WEISSE RING müsse sich stärker auf neue Deliktphänomene einstellen?
Ja, neben der Verrohung und Gewalt im Netz gehören auch die moderne Form des Enkeltricks, Phishing-Mails und KI-gesteuerte Betrugsmaschen dazu. Ich habe neulich erst eine SMS bekommen: „Hallo Papa, ich habe eine neue Telefonnummer.“ Da dachte ich: „Sehr schön, jetzt bin ich plötzlich Papa.“ Das ist natürlich eine offensichtliche Betrugsmasche, aber die Menschen müssen auch wissen, dass Banken keine unseriösen E-Mails schreiben und dass Polizisten zu Hause keine Wertsachen oder vermeintliches Falschgeld sicherstellen. Prävention ist nicht ohne Grund ein Satzungsziel des WEISSEN RINGS.
Neu ist auch das Sozialgesetzbuch 14 (SGB XIV), das im Januar 2024 das bisherige Opferentschädigungsgesetz abgelöst hat. Der WEISSE RING hat ja wiederholt auf Missstände beim alten OEG hingewiesen. Sehen Sie bereits Verbesserungen für die Opfer?
Das Gute ist: Der Katalog nach dem SGB XIV ist größer geworden. Theoretisch können Betroffene von Gewalttaten nun höhere Entschädigungen erhalten. Das Problem ist aber nach wie vor, dass die Opfer dafür oft immer noch zu einem Gutachter müssen, was wieder zu Retraumatisierungen führen kann.
Wir haben bislang den Eindruck, dass die Versorgungsämter seit der Umstellung des OEG auf das SGB XIV vor allem mit sich selbst beschäftigt sind.
Ich glaube, die Umstellung braucht noch ein bisschen Zeit. Das ist ein behördeninternes Verfahren und betrifft die gänzliche Umstellung der IT.
Wie sieht denn derzeit das Verhältnis zu den Landessozialämtern aus?
Nach der Veröffentlichung unserer Recherche „Tatort Amtsstube“ in unserem Magazin vor zwei Jahren, in der wir Missstände bei der Umsetzung des damaligen Opferentschädigungsgesetzes veröffentlicht haben: eher holprig. (Sie lacht.)
Es gibt aber viele Bemühungen, die Zusammenarbeit mit den Landessozialämtern zu verbessern und uns besser zu verknüpfen. Wir haben in Brandenburg und auch in anderen Bundesländern zum Beispiel unsere Außenstellen mit den Mitarbeitern der Behörden zusammengebracht, sodass jeder auch auf Augenhöhe sieht, wer da eigentlich mit wem zu tun hat.
Im nächsten Jahr soll es weitere Treffen auf regionaler Ebene geben, um zu schauen, ob sich für die Opfer qualitativ etwas an der Arbeit geändert hat.
Stichwort Opfer: In Frankreich findet zurzeit ein aufsehenerregender Vergewaltigungsprozess statt. Die Betroffene, Gisèle Pelicot, möchte, dass das, was sie erlebt hat, öffentlich diskutiert und gezeigt wird. Sie machte Schlagzeilen mit dem Satz: „Die Scham muss die Seite wechseln!“ Verfolgen Sie den Fall?
Das ist ein sehr krasser Fall. Ich finde, diese Frau ist sehr mutig, und es ist bemerkenswert, dass sie die Scham nicht annimmt. Ich hoffe, dass sie ein Vorbild für andere betroffene Frauen sein kann und sie ermutigt, selbstbewusst zu sagen: „Ja, ich bin vergewaltigt worden, aber es war definitiv nicht meine Schuld!“
Meinen Sie, dass sich durch den Prozess auch das Opferbild in Deutschland nachhaltig ändern kann?
Ich hoffe es sehr. Es herrscht bei einigen Menschen leider immer noch das Stereotyp, Betroffene seien selbst schuld, weil sie zum Beispiel das falsche Kleid getragen haben. Auch Verteidiger arbeiten oft in diese Richtung. Da muss sich etwas ändern.