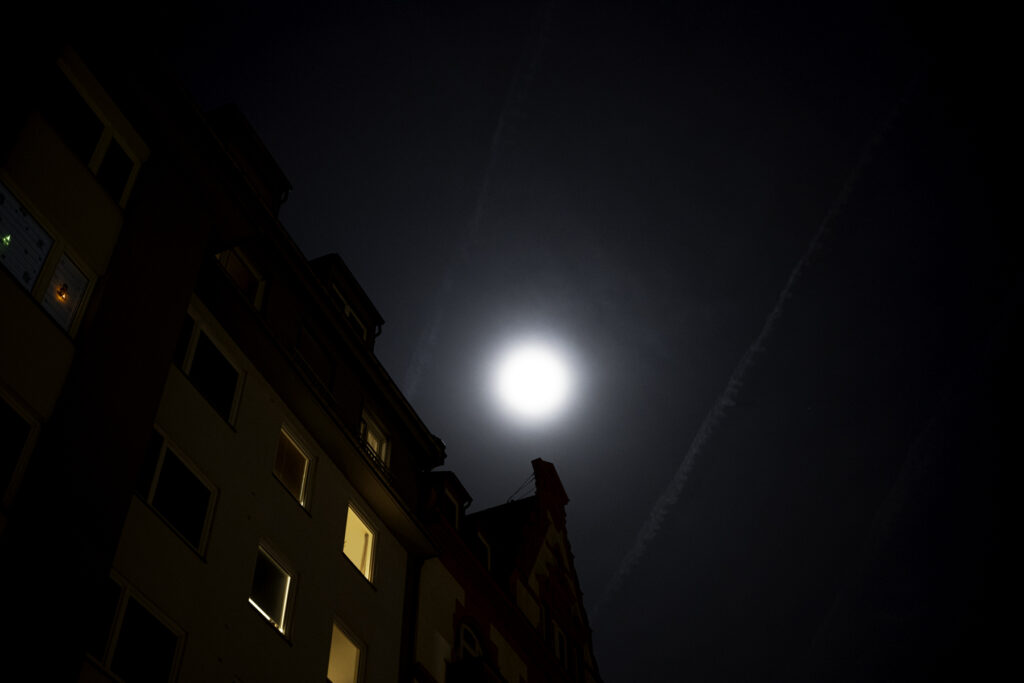Holger Münch (BKA) sowie die Bundesminister Alexander Dobrindt und Karin Prien (v.l.) präsentieren die Dunkelfeld-Studie über Gewalterfahrungen. Foto: Christian Marquardt/NurPhoto
Datum: 10.02.2026
Studie zeigt großes Dunkelfeld bei Gewalt
Eine neue Dunkelfeldstudie des Bundeskriminalamts im Auftrag der Bundesregierung zeigt, dass viele Gewalttaten nicht angezeigt werden. Besonders betroffen sind Frauen, junge Menschen und queere Personen.
Gewalterfahrungen gehören für viele Menschen in Deutschland zum Alltag, werden aber oftmals nicht angezeigt. Dies zeigt die erste Dunkelfeldstudie „Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag“ (LeSuBiA) des Bundeskriminalamtes (BKA) im Auftrag der Bundesregierung. Demnach werden Gewalttaten nur in weniger als zehn Prozent der Fälle der Polizei gemeldet; bei psychischer und körperlicher Gewalt in oder nach einer Beziehung sind es sogar unter fünf Prozent.
„Gewalt ist kein Randphänomen, sie betrifft Millionen Menschen in unserem Land“, sagte Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU), die die Studienergebnisse gemeinsam mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) vorstellte. Fast jede sechste Person erlebe körperliche Gewalt in der Partnerschaft; 19 von 20 Taten würden aber nicht angezeigt. „Dieses Schweigen ist kein individuelles Versagen, sondern Ausdruck von Angst und offenbar fehlenden Zugängen zu Hilfe“, sagte Prien.
Für die Studie wurden rund 15.000 Personen im Alter von 16 bis 85 Jahren zwischen Juli 2023 und Januar 2025 befragt. Im Fokus standen Erfahrungen insbesondere mit Partnerschaftsgewalt, sexualisierter Gewalt, Stalking und Gewalt im digitalen Raum. Zudem machten die Befragten Angaben zu Kontakten mit Polizei, Medizin, Justiz und Opferhilfeangeboten.
Digitale Gewalt trifft vor allem junge Menschen
Die Ergebnisse zeigen, dass Gewalt in Deutschland weit verbreitet ist und viele Formen annimmt. Besonders häufig berichten Betroffene von psychischer Gewalt in (Ex-)Partnerschaften: Knapp die Hälfte der Frauen und 40 Prozent der Männer haben diese mindestens einmal im Leben erlebt. Körperliche Gewalt ist seltener, betraf aber innerhalb der vergangenen fünf Jahre Frauen wie Männer. Sexualisierte Gewalt bleibt ein zentrales Problem: Fast jede zweite Person hat im Laufe ihres Lebens sexuelle Belästigung erfahren, Frauen deutlich häufiger als Männer. Auch Stalking ist demnach weit verbreitet und betrifft mehr als jede fünfte Person im Laufe des Lebens. Digitale Gewalt erleben vor allem junge Menschen: In den vergangenen fünf Jahren war jede fünfte Frau und jeder siebte Mann betroffen, bei 16- bis 17-Jährigen sogar die Mehrheit der jungen Frauen. Besonders stark mit Gewalt konfrontiert sind Personen mit Einwanderungsgeschichte – vor allem Frauen – sowie Angehörige der LSBTIQ*-Community.
Bundesinnenminister Dobrindt kündigte an, den Opferschutz zu stärken. „Es geht darum, die Opfer von Gewalt in den Mittelpunkt zu stellen“, sagte er und verwies unter anderem auf die Einführung der elektronischen Fußfessel nach spanischem Modell. Der WEISSE RING begrüßt diesen Schritt ausdrücklich. Die Opferhilfeorganisation setzt sich seit vielen Jahren für den Einsatz der elektronischen Aufenthaltsüberwachung ein, um Betroffene besser vor weiteren Übergriffen zu schützen.
Mit der LeSuBiA-Studie kommt Deutschland einer zentralen Verpflichtung aus der Istanbul-Konvention nach, die auf die Verhinderung von Gewalt gegen Frauen abzielt. Vorgesehen sind unter anderem umfassender Opferschutz, wirksame Prävention und konsequente Strafverfolgung.